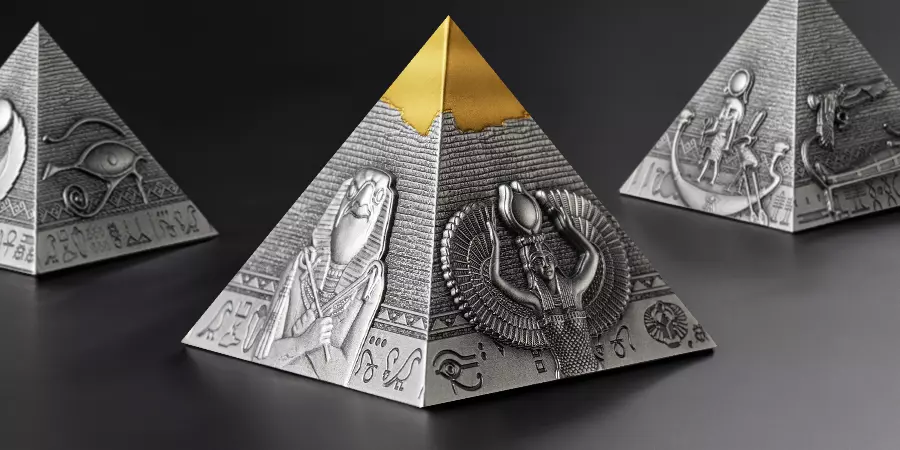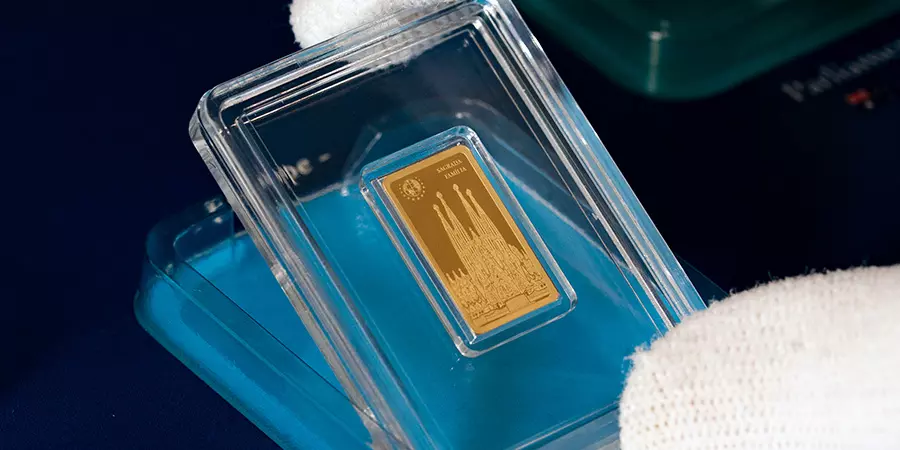Das große Reppa Münzen-Lexikon
A
267 Beiträge in dieser Lexikon KategorieA (Münzstättenzeichen)
Kennbuchstabe der europäischen Münzstätten Paris, Berlin und Wien. Das A steht auf französischen Münzen seit 1539 für die Münzstätte Paris, auf preußischen Münzen seit 1750 für Berlin und von 1766 bis 1868 auf österreichischen Münzen für Wien. Alle Münzstätten führten überdies auch Prägungen im Auftrag anderer Länder aus. So findet sich das Pariser A auch auf Prägungen französischer Kolonien, einiger mittel- und südamerikanischer Länder sowie Monaco (1878-1904) und der Sc...
A. H.
Abkürzung (Anno Hegirae) für die Ära des islamischen Kalenders nach dem Mondjahr. Die meisten arabischen und islamischen Münzen sind danach datiert. Die Zeitrechnung des islamischen Kalenders beginnt mit der Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina (Hidschra), die 622 nach christlicher Zeitrechnung datiert ist. Die mohammedanische Zeitrechnung basiert auf dem Mondjahr von nur 354 Tagen. Sie wird in die christliche Zeitrechnung umgerechnet, indem man sie mit 0,97 multipliziert und 622 add...
AA
Ursprünglich das Münzzeichen für Marseille (das zweite A kopfstehend über das erste gelegt) im 17. Jh. Von 1693 bis 1802 Kennbuchstabe für die französische Münzstätte Metz. Bei der Eröffnung der Münzstätte Metz 1662 war ein gekröntes M ihr Kennzeichen.
Aachener Gulden
Rechnungsmünze der Reichsstadt Aachen, als Wert von 6 Aachener Mark, im 17. Jh. auch ausgeprägt.
Aachener Mark
Silbermünze der Reichsstadt Aachen, von 1577 bis 1754 geprägt, bis 1821 als Rechnungsmünze benutzt. Ursprünglich entfielen 26 Aachener Mark auf den Reichstaler, in der Mitte des 18. Jh.s waren es 72, später dann 54 Mark. 1 Aachener Mark = 6 Bauschen = 24 Aachener Heller.
Abacus
Lateinische Bezeichnung des Rechenbretts, auf dem mit Hilfe von Zählsteinen (lat. calculus) oder Glasperlen schon in der Antike einfache Rechenoperationen durchgeführt wurden. Herodot berichtet, dass die Ägypter mit Steinchen rechneten, aus Griechenland ist die marmorne Rechentafel aus Salamis bekannt. Der Abacus der Römer ist auf römischen Münzen dargestellt, zwei Exemplare sind noch erhalten. Er war ideal zum Ausführen einfacher Rechnungsarten mit der Methode des „Rechnens auf Linien
Abbasi
Nach Schah Abbas I. (1587-1629) aus der Safawiden-Dynastie benannte persische Silbermünze. 1 Abbasi = 4 Shahi = 10 Bisti = 40 Kazbeki = 200 Dinar, 50 Abbasi = 1 (goldener) Toman. Der etwa seit 1620 geprägte Abbasi wog ursprünglich etwa 7,7 g; das Gewicht verringerte sich allmählich, bis die Prägung um die Mitte des 18. Jh.s versiegte. Nach Einführung der Rupie durch Nadir Schah (1736-1747) in Persien wurde diese mit 2 1/2 Abbasi bewertet.
Nach 1762 wurden in Georgien und einigen Khanaten A...
Abbasidenmünzen
Münzen der islamischen Abbasiden-Dynastie, nach ihrer Abstammung von Abbas, einem Onkel Mohammeds, benannt. Die Abbasiden lösten 750 n. Chr. die Omajjaden auf dem Kalifenthron ab. Die orientalische Herrscherdynastie wurde 1258 n. Chr. in Bagdad von den Mongolen entmachtet und bestand noch als Scheinkalifat von Cairo bis 1517 fort. Die silbernen Dirhems und goldenen Dinare der Abbasiden zählen zu den am häufigsten vorkommenden orientalischen Münzen der islamischen Welt. In Europa gab es Fund...
Abdruck
Negativform von Münzen und Medaillen, die zur Herstellung eines positiven Abgusses dienen. Meist werden die Konturen der Münzen durch Stanniol oder dünnes Aluminium genommen und mit Wachs oder Kunstharzen stabilisiert. Diese Negativform wird dannausgegossen, häufig mit Zinn oder zinnhaltigen Legierungen.
Abeele, Pieter van
Niederländischer Medailleur und Graveur der holländischen Schule, der von 1640 bis 1677 in Amsterdam arbeitete. Meisterlich beherrschte er die Technik der getriebenen Hohlmedaille, wobei er die zwei Seiten der Medaille getrennt herstellte und dann durch einen Ring verband. Sein Medaillenwerk umfasst Gedenk- und Porträtmedaillen, u.a. auf die Oranier Wilhelm (Willem) I. und II., niederländische Seekriegshelden sowie Darstellungen von Seeschlachten.
Abendmahlpfennig
Kommunionspfennig
Keine Münzen, sondern Marken, die zur Teilnahme am Abendmahl berechtigten, meist in calvinistischen und reformierten Kirchengemeinden in Gebrauch. Von Calvin 1561 eingeführt, verbreiteten sie sich in der Schweiz, Frankreich und Schottland, seit dem 18. Jh. auch in den USA und Kanada. Sie bildeten häufig Kelche und Hostien ab und waren aus Blei oder Zinn, seltener aus Bronze.
Abgang
Münztechnischer Begriff für den Schwund von Edelmetall bei der Münz- und Medaillenherstellung. Abgang entsteht bei der Wärmebehandlung (Schmelzen,Gießen) des Prägemetalls durch Verbrennen, Verspritzen oder beim Übergang in die Tiegelwand oder die Gussform. Durch das Erhitzen und das Abkühlenentstehen Abgase, die Abgang mit sich führen, ebenso durch die chemischen Prozesse beim Beizen der Münzen. Der Abgang wurde von Anfang aneinkalkuliert, geschätzt und bei der Legierung zugesetzt. Ei...
Abguss
Münztechnischer Ausdruck für das Ausgießen einer Münz- oder Medaillenform und Bezeichnung für das mit diesem Vorgang hergestellte Endprodukt. Abgüssedienen der numismatischen Forschung zur Komplettierung von Münzreihen und der Münzfotografie bei der Zusammenstellung von Tafeln.
Abkürzungen
Abbreviaturen
1. Kurzformen und Kürzel kommen auf fast allen Münzen von der Antike bis zur Gegenwart vor. Um Platz für bildliche Darstellungen zu erhalten, musste dieBeschriftung meist stark abgekürzt werden. Dies gilt nicht für islamische Prägungen, die jahrhundertelang auf Münzbilder verzichteten. Das schuf Platz, um die Münzen vorbildlich mit Daten zu versehen. Die Abkürzungen betreffen u.a. Münzorte, Namen, Titel und Ehrenbezeichnungen von Herrschern, Münzbeamte,Münzmeister und M...
Ablassmünzen
Keine Münzen, sondern Medaillen oder religiöse Gnadenzeichen, manchmal kunstvoll aus Edelmetallen gefertigt, z.B. Amulette, Wallfahrtsmarken und Weihemedaillen. Zwischen dem 16. und 19. Jh. wurden Ablasspfennige oft auf Pilgerfahrten verteilt.
Abnutzung
Durch den Geldumlauf erlittener Abrieb von Münzen. Als das Feingewicht noch den Wert von Edelmetallmünzen bestimmte, wurden diese aus dem Verkehr gezogen, sobald ihr Gewicht unter ein festgesetztes Passiergewicht gesunken war. Im 19. Jh. wurde in den meisten Staaten die Regelung eingeführt, dass alle Münzen, die an Erkennbarkeit oder Gewicht erheblich verloren haben, vom Staat eingezogen und ersetzt werden.
Abondio, Antonio
Bedeutender Medailleur und Wachsbossierer der Spätrenaissance, der aus einer Mailänder Künstlerfamilie stammte. Abondio arbeitete hauptsächlich in Prag und Wien am Hof der Kaiser Maximilian II. (1564-1576) und Rudolf II. (1576-1612) sowie an deutschen Fürstenhöfen. Eine ganze Reihe seiner zahlreichen Medaillen zeigen ausdrucksvolle Porträt-Darstellungen der kaiserlichen Familie und ihres höfischen Umfelds. Außerdem geht die Schöpfung des Doppeladlers auf böhmischen und ungarischen Mü...
Abraham, Jakob
Medailleur und Stempelschneider russischer Herkunft, der seit etwa 1750 für die preußische Krone die Stempel schnitt. Zunächst arbeitete er an den Münzen von Berlin, Stettin, Königsberg, Danzig und Dresden, bevor er sich um 1760 an der "Neuen Münze" in Berlin niederließ. Als Vertreter des klassizistischen Stils gravierte er eine Vielzahl von Stempeln für Münzen und fertigte Medaillen, u.a. zur 500-Jahrfeier von Königsberg (1755). Ihm wird die Schaffung eines neuen Typs des preußischen...
Abramson, Abraham
Unter Anleitung seines Vaters, Jakob Abraham, trat Abramson 1771 in preußische Dienste und wendete sich schon bald dem Gebiet der Medaillenkunst zu. Zwischen 1787 und 1791 reiste er zu Studienzwecken ins Ausland, u.a. nach Italien, und begann sich bald auf dem Gebiet der Porträt- oder Bildnismedaillen einen Namen zu machen. Der vielleicht bedeutendste deutsche Medailleur des Klassizismus schuf u.a. Suitenmedaillen auf deutsche Gelehrte (darunter Lessing, Kant, Herder und Wieland), mehrere Meda...
Abschieben
Bezeichnung für das strafbare Weitergeben unechter Geldzeichen „nach bekannter Unechtheit“ zur Abwendungeigenen Schadens.
Abschlag
1. Probemünze zur Beurteilung des Stempelschnitts und als Vorlage zur Prägegenehmigung (Probeabschlag).Abschläge wurden unter Verwendung der Originalstempel meist aus einem anderen Metall geschlagen, als es für die reguläre Prägung vorgesehen war. Manchmal sind Abschläge auch für hochgestellte Sammler speziellhergestellt worden oder dienten als Spekulationsobjekte des Münzmeisters.
2. Siehe Disagio
Abschnitt
Der untere, vom Münzbild deutlich abgetrennte Teil der Münzfläche, frz. und engl. exergue. In Versandkatalogen wird meist die Abkürzung i.A. verwendet. Im Abschnitt wurden auf antiken Münzenhäufig der Name des Münzherren, die Münzstätten und auf römischen Münzen die Offizinzeichen (siehe Officina) angebracht. In der Neuzeit steht meist die Jahreszahl, die Wertangabe oder das Zeichen desPrägeorts.
Abschrote
Frühere Bezeichnung für den Abfall, der bei der Herstellung der Schrötlinge aus den Zainen anfiel. Die Abschrote wurden, ebenso wie die heute anfallenden Stanzgitter, eingeschmolzen und wiederzu Zainen verarbeitet, heute würde man sagen recycelt.
Absolutionstaler
Anlässlich der Freisprechung vom Kirchenbann des französischen Königs Heinrich IV. durch Papst Clemens VIII. im Jahr 1595 geprägte Medaille. Sie zeigt das Brustbild des Königs auf der einen und das desPapstes auf der anderen Seite.
Abt
Lat. abbas, Vorsteher einer katholischen Ordensgemeinschaft, der eine Abtei (Stift, Kloster)leitet. Im Mittelalter waren zahlreiche Benediktinerabteien mit Reichsbesitz belehnt, damitstanden die Äbte im Rang eines Reichsfürsten und konnten das Münzrecht ausüben, wie z.B. die Äbte vonCorvey, Echternach, Ellwangen, Fulda, Hersfeld, Reichenau, und St. Gallen (Klöster). Auch in Burgund, Frankreich und Spanien entstanden Prägungenvon Äbten. Die auf Münzen dargestellten Abtsinsignien&nbs...
Äbtissin
Lat. abbatissa, Vorsteherin eines Nonnenklosters oder Frauenstifts. Zu den prägeberechtigten Äbtissinnenzählten u.a. die Vorsteherinnen der Klöster von Eschwege, Essen, Herford, Gandersheim, Nordhausen und Quedlinburg.
Abu
Arabischer Wortbestandteil verschiedener Bezeichnungen für europäische Münzen, die durch den Levantehandel in arabischen Staaten verbreitet waren. Die Beinamen der Münzen beziehen sich meist auf dasMünzbild, z.B. wurde der Maria-Theresien-Taler Abu Kush (Vater des Vogels) oder Abu Noukte (Vater der Perlen) genannt, wegen des Adlers bzw. der Perlen auf dem Diadem der Kaiserin. In Ägypten wurde die Münze Abu Tera genannt, der letzte Wortbestandteil ist eine Abkürzung für Theresia. Der nie...
Abundantia
Verkörperung des Überflusses und Wohlstands, die auf römischen Münzen der Kaiserzeit als weibliche Person in Verbindung mit Füllhorn, Scheffelmaß oder Ähren erscheint.
Abwertung
Im modernen Sinn die Herabsetzung des Außenwertes einer Währung zur Anpassung an einen im Geldverkehrschon bestehenden Zustand. Geschichtlich versteht man unter Abwertung die Verringerung des Gold- oder Silberanteils in gebräuchlichen Münzen. Im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit war die Abwertung ein beliebtes Mittel zur Erhöhung der Einnahmen aus der Münzprägung (Schlagschatz). Die Mehreinnahmen dienten in der Regel der Kriegsfinanzierung. Nach mehreren Abwertungen musste der M
Academia in Nummis
Das Sammeln spezieller Münzen und Medaillen von Hochschulen, Universitäten und sonstigen Lehranstalten. Dazu zählen auch Gedenkmünzen auf bekannte Wissenschaftler, Forscher und Gelehrte sowie Ehren- und Preismedaillen von Forschungs- und Lehranstalten.
Medaille auf die 500-Jahrfeier der Universität Wien
Achämeniden
Alte persische Dynastie, nach ihrem sagenhaften König Achaimenes benannt, der um 700 v. Chr. über die Perserstämme geherrscht haben soll. Das Reich der Achämeniden ging aus dem Gebiet der Persis hervor und konnte unter Kyros (II.), dem Großen, 550 v. Chr. die Vorherrschaft der Meder brechen und 546 v. Chr. das Lydische Reich des Kroisos (der sagenhaft reiche König Krösus) sowie griechische Städte an der Westküste Kleinasiens erobern. Seitdem war das Perserreich in der Lage, wirtschaftli...
Achatperlen
Schwarz-weiße Achatperlen fanden im islamischen Raum seit dem 18. Jh. als Zahlungsmittel und für Gebetsketten Verwendung. Sie wurden in den Wasserschleifen Idar-Obersteins hergestellt und vonden Achatfärbern mühsam schwarz-weiß eingefärbt. Über Mekka, Medina und die Karawanenstation Omdurman(Sudan) wurden die Stücke im gesamten islamischen Gebiet zwischen Pakistan und Westafrika verteilt.
Acheson
Schottische Münzgraveure und Stempelschneider (Vater und Sohn), die im 16. Jh. für die schottischen Königearbeiteten. Der ältere, James Acheson, wurde 1525 unter König Jakob V. Münzmeister und soll 1539 seinesAmtes enthoben worden sein, weil er sich angeblich weigerte, Bawbees zu prägen. Sein Nachfolger wurde sein Sohn John Acheson, der über 30 Jahre viele schöne Münzen unter Königin Maria Stuart schnitt.
Acht-Reales-Stück
Deutsche Bezeichnung einer spanischen Großsilbermünze (Real de a Ocho) zu acht Reales, die zum ersten Mal unter dem Königspaar Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien nach der Pragmatischen Sanktion von Medina del Campo (1497) – wenn auch in geringer Anzahl – geschlagen wurde. Die Prägung wurde dann unter der Herrschaft Johannas und ihres Sohnes Carlos I. (1516-1556), der als Kaiser Karl V.(1519-1556) über ein Weltreich herrschte, in dem "die Sonne nie untergeht" (Deutsch-Römis...
Achtbrüdertaler
Münzen aus Sachsen-Weimar mit den Hüftbildern der acht noch jungen Söhne Herzog Johanns (1573-1605) aus den Jahren 1607-1619. Sie standen zuerst unter der Vormundschaft des Kurfürsten Christian II. von Sachsen (1591-1611) und nach dessen Tod bis 1615 unter der Vormundschaft von Johann Georg I. von Sachsen (1611-1656). Es handelt sich um Johann Ernst (1615-1625), Friedrich (1615-1622), Wilhelm (1615-1640), Albrecht (1615-1640), Johann Friedrich (1615-1628), Ernst (1615-1640), Friedrich Wilhel...
Achtehalber
Brandenburgischer-Zwölfteltaler
Bezeichnung des brandenburgischen Zwölfteltalers, der in West- und Ostpreußen seit 1722 auf den Wert von 7½ preußische Groschen festgesetzt wurde, vom achten Groschen also nur die Hälfte.
Achtelkreuzer
Scheidemünze im Wert von einem Heller, von den Herzogtümern Sachsen-Hildburghausen (1825), Sachsen-Meiningen (1828) und dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (1840 und 1855) geprägt.
Achteltaler
Im 17. Jh. im Westen Deutschlands sehr verbreitete Teiltalermünze im Wert von drei Groschen.
Achtentwintig
Zunächst Rechnungseinheit im Wert eines Goldguldens bzw. von 28 Stübern. 1601 zum ersten Mal von der Provinz Friesland in Silber ausgeprägt, verbreitete sie sich im Laufe des Jh.s auch in anderen niederländischen Provinzen und verlor während der (kleinen) zweiten Kipperzeit so sehr an Wert,dass sie 1693 bis auf einige gegengestempelte Stücke für den Umlauf verboten wurde. Die minderwertige Entsprechungdes Goldguldens ist nach ihrem Wert in Stübern (achtentwintig = achtundzwanzig) benannt...
Achter
Beiname des niedersächsischen Mariengroschens in Obersachsen, der dort mit 8 Pfennigen bewertet wurde. In Sachsen wurde ein 8-Pfennig-Stück als Achter bezeichnet, allerdings nur 1808/9 ausgemünzt.
Achtheller
Münznominal im Wert von 4 Pfennigen, vom späten 16. Jh. bis in das 18. Jh. im Rheinland verbreitet.Volkstümlich auch Fettmännchen genannt.
Achtling
Achtpfenniger
Umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene Münzen, deren Wert 8 Pfennigen entsprach, auch Achtpfenniger genannt. Dazu zählen die Göttinger Körtlinge, die Mariengroschen nach der Kipperzeit unddie süddeutschen Halbbatzen oder 2-Kreuzer-Stücke (Zweier). Im erzbischöflichen Kurfürstentum Trierwerden die Achtpfennigstücke aus dem 17. Jh. Petermännchen genannt.
Achtpass
Acht nach außen gerundete Bögen, die das Münzbild umrahmen. In der mittelalterlichen Gotik war die ornamentale Verzierung des Münzbilds mit Bögen ein beliebtes Stilelement auf Münzen, meist wurden Drei- oder Vierpass verwendet. Der Achtpass findet sich auch noch auf neuzeitlichen Großsilbermünzen, wie dem Acht-Reales-Stück, dessen größerer Schrötling mehr Platz bot, als die im Durchmesser meist kleineren Münzen des Mittelalters.
Achtzehnerlein
Name für mansfeldische, sächsische und schwarzburgische Spitzgroschen aus dem 16. Jh. im Wert von 18 Pfennigen, 16 Achtzehnerlein entfielen auf den Reichstaler. Nach der Reichsmünzordnung von 1566 wurden die Achtzehnerlein nicht mehr zugelassen, Reststücke wurden auf dem Kreisabschied von Halberstadt 1577 auf 15 Pfennige abgewertet.
Achtzehngröscher
Polnische und preußische Silbermünze im 17. und 18. Jh. Die Entstehung dieses Münztyps geht auf einen Vorschlag des Posener Münzpächters Andreas Timpf aus dem Jahr 1663 zurück, geringhaltige Silbermünzen (500/1000) zu prägen und sie im Wert eines Guldens (Zloty) zu 30 polnischen Groschen (Guldentympfe) auszugeben. Die Guldentympfe verbreiteten sich, trotz anfänglichen Verbots in Preußen, sehr schnell und wurden für 18 Groschen im Umlauf geduldet, obwohl ihr innerer Wert nur 13 Grosche...
Ackey
Silbermünze, von der britischen African Company of Merchants 1796 und 1818 für das Gebiet der Goldküste (Ghana) herausgegeben. 1 Ackey = 8 Tackoe.
Acmonital
Münzwerkstoff, in Italien und vom Vatikan statt Nickel oder Kupfer verwendeter Chromstahl (Stahl:81,75 %, Chrom: 18,25 %) für Scheidemünzen, z.B. für das 50-Lire-Stück.
Adhio
Kleine Kupfermünze im indischen Katsch (Kutch), einer von der britischen Kolonialmacht abhängigen Halbinselim Nordwesten Indiens. Die Raschputen von Katsch ließen bis 1947 Münzen im Namen des britischen Monarchen prägen. Der Adhio im Wert von ½ Kori (Adha = ½) wurde bis 1946 geschlagen.
Adlea
Auch Adli, bezeichnet eine vergoldete Billonmünze, die Pascha Yussuf von Tripoli 1927 im Gegenwert eines spanischen Dollars einzuführen versuchte. Der Betrug wurde früh bemerkt, sodass die Münze nur zu 10 % ihres Nominalwerts akzeptiert wurde.
Adler
In der Antike ursprünglich als Göttersymbol verwendet. Auf griechischen und römischen Münzen wird der Adler wegen seines hohen Fluges meist als Begleiter von Zeus bzw. Jupiter, z. B. mit dem Blitz in den Fängen, dargestellt. Im römischen Reich wird er allmählich Wahrzeichen für die höchste weltliche Macht, besonders als Feldzeichen der römischen Legion (Legionsadler). Zu den ältesten Münzen des Mittelalters mit Adlerdarstellung gehören die in Maastricht hergestellten Pfennige Friedr...
Adlerdollar
Adlerpiaster
Neben Adlerpiaster deutsche Bezeichnung für den mexikanischen Silberpeso, der auf der Münzvorderseite einen Wappenadler auf einem Kaktus zeigt.
Adlergroschen
Aquilino
Italienisch Aquilino grosso, ist die erste Mehrpfennigmünze (Grosso) des deutschen Sprachraums.Ihr Wert war ca. 20 Berner (Perner), deshalb auch Zwainziger (Zwanziger) genannt. Auf der Vorderseite ist ein naturalistischer Adler (ital. Aquilino) abgebildet, die Rs. zeigt ein Kreuz. Diese Münzewurde ab 1259 unter Meinhard in Meran geprägt und verbreitete sich im oberitalienischen Wirtschaftsraum, wo sie auch vielfach nachgeahmt wurde, z.B. in Mantua, Padua, Treviso, Verona und Vicenca.
Adlerpfennig
Im weiteren Sinn werden alle mittelalterlichen Pfennige mit Adlerdarstellungen als Adlerpfennige bezeichnet, wie z.B. mittelalterliche Pfennige aus dem Breisgau, aus Lothringen, Straßburg und Frankfurt a. Main. Im engeren Sinn werden die brandenburgischen Hohlpfennige des 14. und 15. Jh.s Adlerpfennige genannt. Auch ein Typ der Nürnberger Rechenpfennige aus dem 15. Jh., der einen einköpfigen Adler zeigt,wird als Adlerpfennig bezeichnet.
Straßburger Adlerpfennig
Adlerschilling
In Deutschland gebräuchliche Bezeichnung für den niederländischen Arendschelling.
Adli
1. Bezeichnung einer Gold- und Silbermünze, die um 1325 n. Chr. (725 AH) unter Muhammad III. bin Tughluq (1325-1351) im Sultanat Dehli eingeführt wurde. Im Prinzip handelt es sich um den um ca. 16% leichteren Tanka, deshalb manchmal auch als „leichter Tanka“ bezeichnet. Die Münzen konnten sich nicht durchsetzen, der silberne Adli wurde bereits zwei Jahre später wieder aufgegeben, der goldene Adli hielt sich ein paar Jahre länger.
2. Siehe Adlea.
Adlocutio
Ansprache des Kaisers an das Heer, ein Motiv, das auf römischen Münzen des römischen Kaiserreichs vom 1. bis 3. Jh. n. Chr. dargestellt ist. Ein verbreiteter Typ zeigt den Kaiser mit leicht erhobenem Arm (Rednerpose) vor den Soldaten.
Administrationsdukat
Goldener Dukat bzw. Silbergulden aus Baden (Durlach), die beide unter der Vormundschaft der Markgräfinwitwe Magdalene Wilhelmine (1738-1742) aus dem Hause Württemberg und Karl August (1738-1745) für Karl Friedrich von Baden geprägt wurden, der noch im Knabenalter war. Die provisorischen Regenten weisen sich auf den Umschriften der Vs.n als Administratoren aus, danach sind die Münzen benannt. Der aus Rheingold und eingeschmolzenen Karolinen 1738 geprägte Dukat zeigt auf der Vs. den von zwei...
Administrationstaler
Bezeichnung verschiedener württembergischer Talermünzen aus den Jahren, als der noch junge Herzog Karl Eugen (1737-1793) unter der Vormundschaft der Regenten Karl Rudolph von Württemberg-Neuenstadt (1737/38) und Karl Friedrich von Württemberg-Oels (1738-1744) stand. Beide Regenten bezeichnen sich auf den Münzen als Administratoren und Tutoren. Der 1737 geprägte Taler zeigt auf der Vs. die Büste Karl Rudolphs, auf der Rs. den gekrönten Ovalschild mit Wappenmantel (obere Umschrift SALUTI P...
Adolph d'or
Beiname des schwedisch-pommerschen 5-Taler-Goldstückes (Pistole), das unter dem schwedischen König Adolph Frederik (1751-1771) in Stralsund geprägt wurde. Es gab auch Doppelstücke zu 10 Talern. Sie zählen zu den schwedischen Besitzungsmünzen.
Adolphin
Beiname für das schwedische 2-Mark-Stück (Carolin), das unter König Adolph Friedrich (1751-1771) geschlagen wurde.
Adventus
Reisemünzen
Die Ankunft (lat. adventus) der römischen Kaiser in der Hauptstadt Rom ist ein Ereignis, das auf Geprägen der römischen Kaiserzeit nicht selten dargestellt wurde. Diese Ausgaben zeigen meist den Kaiser hoch zu Ross, die rechte Hand zum Gruß erhoben, die Stadt oft durch die Roma oder Bauwerke Roms im Hintergrund gekennzeichnet. Auch die Göttinnen Victoria oder Felicitas und Soldaten im Gefolge oder zu Füßen des Kaisers am Boden liegende Feinde – Personifikationen der besiegt...
AE
In Katalogen oft benutzte Abkürzung antiker Münzen aus unedlen Metallen (Bronze- oder Kupfermünzen). In Katalogen ist der Ausdruck häufig in Ligatur gesetzt (Æ). Siehe Aes.
Aegis
Ursprünglich ein Attribut des Zeus, eine Art Überwurf über den Arm, der mit Schlangen bedeckt ist. Die Aegis kommt als Schmuck des Kaiserporträts am Halsabschnitt auf römischen Münzen der Kaiserzeit gelegentlich vor.
Aequitas
Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit und Billigkeit, erscheint schon auf Münzen der römischen Republik. Auf Münzen der Kaiserzeit häufen sich etwa seit der Mitte des 1. Jh. n. Chr. die Darstellungen der Göttin, meist als weibliche Ganzfigur mit den Attributen Waage, Füllhorn und Zepter. Sie wird auch als Tugend der Kaiser gedeutet. Die Aequitas findet sich auf römischen Münzen häufiger als die Iustitia, die in der Neuzeit häufiger dargestellt ist, oftmals mit verbundenen Augen.
Aes
Lateinischer Ausdruck für Kupfer und Bronze, abgekürzt Æ. Bei den italischen Bewohnern Mittelitaliens (Römer, Etrusker, Campanier u.a.) übernahm das Aes die Rolle als Wertmesser und Zahlungsmittel und bedeutete Erz- oder Kupfergeld sowie Geld allgemein. Die ist ein Hinweis auf den Ursprung des römischen Geldes, das vor der Einführung der Münze aus einer Kupfer- und Bronzewährung (Barren) bestand. In der Numismatik werden alle Münzen aus einer Legierung, die überwiegend aus Kupfer best...
Aes grave
Lateinischer Ausdruck, wörtlich „Schwerkupfer“ und „Schwererz“, der die ersten schweren und großen Kupfermünzen Mittelitaliens und Roms bezeichnet. Sie entstanden in den mittelitalischen Gegenden (Apulien, Campanien, Etruskien, Umbrien) wohl um die Jahrhundertwende (4./3. Jh. v. Chr.), in Rom nicht vor 275 n. Chr. Das plumpe, aber schon münzförmig runde Geld wurde gegossen und mit Punkten und Buchstaben als Wertzeichen versehen. Die Grundeinheit dieses Währungssystems war der As, d...
Aes rude
Lateinischer Ausdruck für Rohkupfer, Roherz. Die numismatisch Aes rude genannten vorgewogenen Gussbarren stellen das erste traditionelle Zahlungs- und Tauschmittel aus Metall dar, das von den Stämmen Mittelitaliens (Etrusker, Römer u.a.) benutzt wurde. Aus dem Aes rude entwickelte sich zum Ende des 4./ Anfang des 3. Jh.s das Aes signatum und schließlich das Aes grave. In Funden kommen Platten, Stangen und (am häufigsten) Bruchstücke dieser Formen vor. Das Aes rude ist manchmal mit kleinen ...
Aes signatum
Lateinische Bezeichnung (wörtlich „gezeichnetes Erz“) für das mit einem Bild versehene, standardisierte, rechteckige Bronzebarrengeld der Italiker und Römer. Historisch gesehen fungiert das Aes signatum als Zwischenstufe in der Entwicklung vom Aes rude zum Aes grave.
Es wurde häufig in Form zerhackter Stücke gefunden, was darauf schließen lässt, dass es wie das Aes rude vorgewogen sein musste. Das römische Aes signatum ist sowohl mit einfachen Zweig- und Fischgrätenmustern bebildert...
Aesculap
Römischer Gott der Heilkunst, von den Griechen übernommen (Asklepios). Erscheint häufig auf römischen Münzen der Kaiserzeit mit dem Aesculapstab (Stab mit Schlange) als Attribut, zuweilen auch zusammen mit Salus.
Aeternitas
Römische Personifikation der Ewigkeit im Sinne des ewigen Lebens der zu Göttern erhobenen verstorbenen Kaiser (Aeternitas Augusti oder Divi), wie sie auf Consecrationsmünzen dargestellt ist. Auch als Personifikation der ewigen Dauerhaftigkeit sowohl des Weltalls als auch des römischen Reiches und des römischen Volkes (Aeternitas imperii, populi romani). Je nach Sinn tritt die auf römischen Münzen als weibliche Gestalt dargestellte Aeternitas mit den Attributen Zepter, Füllhorn, Globus, V...
Affinieren
Münztechnischer Ausdruck für das Scheiden des Kupfers von edelmetallhaltigen Münzen.
Afghani
Afghanische Währungseinheit seit 1926. 1 Afghani = 100 Puls, 20 Afghani = 1 Amani.
Äginäischer Münzfuß
Auch äginetischer oder aiginetischer Münzfuß mit einem Statergewicht von ungefähr 12,3 g war der älteste und zwischen dem 7. und 5. Jh. v. Chr. gebräuchlichste Münzfuß in der Ägäis. Er ist nach der zwischen Attika und Argolis liegenden Insel und gleichnamigen Stadt Aigina benannt. Die in archaischer Zeit bedeutende See- und Handelsstadt Aigina stellte wohl als erste Stadt des griechischen Mutterlands Münzen her, und zwar silberne Didrachmen mit Schildkröten auf dem Münzbild. Durch d...
Agio
Aufgeld
Aufgeld, mit dem der Kurs einer Münze oder eines Wertpapiers den Nennwert übersteigt. Die Differenz zwischen Kurs und Nennwert wird in Prozenten angegeben. Das Gegenteil ist das Disagio.
Agleier
Auch Aglaier genannte Nachprägungen des Friesacher Pfennigs durch die Patriarchen von Aquileja, später auch der Grafen von Görz und des Herzogs von Kärnten. Wegen ihres hohen Feingehalts und der Beständigkeit ihres Gewichts waren die Agleier sehr beliebt und hielten sich von der Mitte des 12. Jh.s bis in die 2. Hälfte des 14. Jh.s.
Agnel
Auch Aignel (veraltet für Lamm) sind Beinamen für den Moutond'or, nach der Darstellung des zurückblickenden Lamms mit Kreuzstab und fliegendem Banner benannt.
Agnel d'or, geprägt unter Karl IV. von Frankreich
Agnelet
Auch Agnelot (Lämmchen) ist die frz. Verkleinerungsform von „agneau“ (Lamm). Als Agnelet werden die Halbstücke der französischen Goldmünze Mouton d'or und ihre Nachahmungen bezeichnet.
Agnus Dei
Eine biblische Prägung – die Bedeutung von „Agnus Dei“
Der lateinische Ausdruck wird übersetzt mit „Lamm Gottes“ und steht seit Jahrhunderten als bildhaftes Symbol für Jesus Christus. Das Motiv wird zuweilen auch Osterlamm genannt. Das Zitat, in welchem dieser Ausdruck am häufigsten Anwendung fand und immer noch findet, stammt ursprünglich aus dem biblischen Kontext. In Joh. I 29 heißt es: „Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, misere nobis“ (zu Deutsch: „Lamm Gottes, das die...
Agora
Bezeichnung der kleinen Währungsmünzen Israels seit 1960. 100 Agorot = 1 Israelisches Pfund, seit 1880 100 Neue Agorot = 1 Schekel.
Agrippiner
Köln-Andernacher-Denare, Niederelbische-Agrippiner
Aus dem lateinischen Namen für Köln (Colonia Agrippinensis) abgeleiteter Name für die wegen ihrer Güte beliebten Kölner Denare und ihre massenhaften Nachprägungen im 11. Jh., die u.a. auch in der Andernacher Münzstätte geprägt wurden (deshalb auch Köln-Andernacher Denare genannt). Köln war zu dieser Zeit eine der führenden Handelsstädte und entwickelte zeitweise den größten Münzbetrieb Europas. Aus den Münzfunden im schwedische...
Ägyptisches Pfund
Das ägyptische Pfund (EGP) ist die offizielle Währung der Arabischen Republik Ägypten, wie in ISO 4217, dem internationalen Standard für Währungscodes, festgelegt. Das Symbol der Währung ist E£, sie kann jedoch auch mit dem Symbol LE bezeichnet werden, welches für die französische Übersetzung von „ägyptischen Pfund“, nämlich livre égyptienne, steht. Das ägyptische Pfund wird inoffiziell auch im Gaza-Streifen und in Teilen des Sudan verwendet. Ein Pfund ist in 100 Piaster und 10...
Ahlborg, Lea
Schwedische Stempelschneiderin und Medailleurin, eine der wenigen Frauen, die sich mit Münz- und Medaillengravur beschäftigte. Als Schülerin ihres Vaters Lundgren führte sie ihr Studium von der Stockholmer Kunstakademie 1851 nach Paris. Nach dem Tod ihres Vaters 1853 übernahm sie dessen Aufgabe als Stempelschneider an der königlichen Stockholmer Münze. Neben vielen Gedenkmünzen und Medaillen schnitt sie bis zu ihrem Tod 1897 in über 40 Jahrensämtliche Stempel für die neuen Münztypen....
Aijubiden
Auch Ayyubiden oder Ajjubiden sind eine islamische Herrscherdynastie in Ägypten, Syrien und Jemen, die durch den berühmten Sultan Saladin (1138-1193) begründet wurde, der 1171 die Fatimiden stürzte, 1187 das Kreuzfahrerheer besiegte und 1192 den Christen freien Zutritt zu den heiligen Stätten gewährte. Die Herrschaft der Dynastie wurde 1250 durch die Mameluken in Ägypten, 1260 durch die Mongolen in Syrien beendet.
AINP
Association-Internationale-Des-Numismates-Professionnels
Abkürzung für Association Internationale des Numismates Professionnels, den 1951 in Genf gegründeten Verband der beruflich tätigen Münzhändler. Seine Ziele sind die Förderung der Numismatik und die internationale Zusammenarbeit. Der Verband garantiert die Echtheit der Münzen der ihm angeschlossenen Händler.
Akce
Auch Aqce ist die erste und für über 100 Jahre einzige Silbermünze der Osmanen. Der Name geht auf die Farbe der Münze zurück und bedeutet „weißlich“ oder silbern. Als Vorbild diente der silberne Asper der Komnenen von Trapezunt. Das wichtigste Zahlungsmittel des Osmanischen Reichs soll bereits unter Otman I. (gestorben 1326) geprägt worden sein; deshalb wird der Akce in der türkischen Literatur auch „Otmani“ genannt. Gesichert ist die Akce-Prägung erst unter seinem Sohn Orhan (1...
Akoriperlen
Bezeichnung der bekanntesten, vornehmsten und kostbarsten Form der Glashandelsperlen, die in weiten Gebieten Afrikas als Schmuck, Wertobjekt und Geld fungierte. In der englischsprachlichen Literatur werden sie Aggri genannt. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und Formen, meist zylindrisch oder leicht gekrümmt und mit millefiorie-ähnlichen Mustern. Ursprünglich waren die Akoriperlen nur der aristokratischen Oberschicht zu zeremonialen Zwecken vorbehalten. Später konnten damit auch Trib...
Aksumitische Münzen
Axum-Münzen
Frühe christliche Münzen aus dem Königreich von Aksum (auch Axum) im Gebiet des heutigen Äthiopien, das schon im 1. Jh. n. Chr. erwähnt wurde. Seit 340 n. Chr. nahm das blühende Königreich das Christentum als Staatsreligion unter den Patriarchen von Alexandria an. Im 5. Jh. löste sich Aksum von der orthodoxen Kirche und zählte nach dem Konzil von Chalkedon (451 n. Chr.) zu den christlichen Monophysiten. Der Hauptanteil der aksumitischen Prägungen besteht aus kleinen Bronze...
Aktie
Wertpapier
Anteil des Aktionärs am Grundkapital einer Aktiengesellschaft. Das Wort leitet sich aus dem lateinischen „actio“ (dt.: klagbarer Anspruch) ab und ist niederländisch, denn im Jahr 1602 führte die Niederländische Ostindische Kompanie die erste Form von Aktienbeteiligung ein. Kolonialgesellschaften auf Aktienbasis verbreiteten sich im 17. Jh. sehr schnell auch in England, Frankreich, Portugal und Spanien, die Anteilsscheine wurden von Anbeginn an der Börse gehandelt. Dabei hande...
al marco
Vorwiegend im Mittelalter angewandte Justierung bei Kleinmünzen. Danach wurden die Münzen nicht einzeln gewogen, sondern lediglich die Stückzahl der auszubringenden Münzen nach einer Gewichtsmark (Mark 1) vorgeschriebener Feinheit festgelegt. Das bedeutete, dass das Gewicht der einzelnen Münzen verschieden war, was trotz Verbots und strenger Bestrafung dazu führte, dass die schwersten Stücke ausgesondert, zurückbehalten oder eingeschmolzen wurden (saigern). Dadurch verblieben nur die lei...
al numero
Im Gegensatz zum al-marco-Prinzip wurden die Gold-, später auch die Silbermünzen al numero (nach der Zahl) und al pezzo (nach dem Stück) justiert.
al pezzo
Justierung der Münzen nach dem Stück. Damit war gewährleistet, dass sich das Gewicht jedes einzelnen Stücks einer Emission im vorgeschriebenen Kulanzbereich (siehe auch Passiergewicht) bewegte und nicht zu leicht und nicht zu schwer in Umlauf gebracht wurde, wie das bei der Justierung al marco üblich war.
Albansgulden
Eselsgulden, St.-Albansgulden
Präsenzmarken im Münzfuß des Goldguldens, die vom St.-Albans-Stift in Mainz im 17./18. Jh. ausgemünzt wurden. Nach einer Anekdote soll der Stiftsprobst Melchior Pfinzing auf seine Bitte nach dem Münzprivileg vom Kaiser folgende Antwort erhalten haben: „Einen alten Esel soll er münzen.“ Am folgenden Tag soll der schlaue Pfinzing dem Kaiser ein bereits unterschriftsreifes Privileg mit einem Esel als Wappen vorgelegt haben. Tatsächlich zeigt der Albansgulden...
Albertin
Albertus
Die um 1600 von den Statthaltern der spanischen Niederlande Albert und Isabella als 2/3-Dukat (im Wert von 2½ Gulden) eingeführte Goldmünze. Ihre Vs. trägt das von einer Vlieskette umgebene bekrönte Wappen, die Rs. das burgundische Kreuz mit dem Goldenen Vlies. In Westdeutschland war der Albertin als Handelsmünze verbreitet und wurde dort Albertus genannt. Es gab auch Halb- und Doppelstücke.
Albertusdaler
Nach dem Vorbild des niederländischen Albertustaler geprägte dänische Handelsmünze, die unter Christian VII. zwischen 1781 u. 1796 für den Ostseehandel in Altona geprägt wurde. Sie zeigt auf der Vs. den Wilden Mann mit Keule und Wappen.
Albertusrubel
Russische Rubelmünze, nach dem Fuß der Albertustaler unter Zar Paul I. 1796 ausgegeben.
Albertustaler
Kreuztaler
Silbermünze der spanischen Niederlande, unter den Gouverneuren Albert und Isabella 1612 eingeführt, nach dem Münzbild (Andreaskreuz) auch Kreuztaler genannt. Aufgrund des hohen Handelsaufkommens zur Haupthandelsmünze im Ostseeraum geworden, wurde der Albertustaler dem im Feingehalt um 1,33 g schwereren Reichstaler sogar gleichgestellt. Im Laufe des 18. Jh.s gab es viele Nachprägungen, z.B. aus Preußen, Braunschweig-Wolfenbüttel, Ungarn, Dänemark, Holstein und Kurland.
Albogalerus
Weiße Mütze, die der Flamen Dialis, der Priester des Jupiter im alten Rom, als Zeichen seiner Würde auf dem Kopf trug und die praktisch als Pontifikalzeichen der höchsten religiösen Würde des antiken Rom auf Münzen zu sehen ist.
Albus
Denarius-Albus
Groschenmünze des Spätmittelalters, die Mitte des 14. Jh.s vom Trierer Erzbischof Kuno von Falkenstein eingeführt und zur Hauptmünze an Mittel- und Niederrhein wurde. Der Name leitet sich vom lateinischen „denarius albus“ (weißer Pfennig) ab, weil die Münze aufgrund des relativ hohen Silbergehalts ihre silbrig-weiße Farbe auch im Umlauf beibehielt. Der Name Weißpfennig wurde 1372 im Münzvertrag zwischen Köln und Trier urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Der Münzvere...
Alchemistenmünzen
Angeblich durch alchemistisches Wissen künstlich hergestellte Edelmetallmünzen oder Medaillen. Der Glaube, aus unedlen Metallen nach Geheimlehren vom „Stein der Weisen“ oder der „Großen Medizin“ Gold oder Silber herstellen zu können, hielt sich hartnäckig das ganze Mittelalter hindurch bis ins 18. Jh. Der Grund war wohl die Verlockung, dadurch kurzfristig steinreich werden zu können.Beispiele für alchemistische Münzen sind die Bechers von 1657, Pfennigers von 1716 oder die Kronem...
Alex d'or
Bezeichnung des goldenen 5-Taler-Stückes (Pistole), das 1752 unter Graf Johann Friedrich Alexander von Wied-Neuwied geprägt wurde.
Alexandriner
Sammelbezeichnung für die in Alexandria während der römischen Kaiserzeit ausschließlich für die römische Provinz Ägypten hergestellten Münzen aus Bronze und Billon, vor allem als Tetradrachmen. Sie zeichnen sich durch stilistische Eigenständigkeit und Typenvielfalt aus. Die Besonderheit dieser Münzen liegt in der Datierung: Auf das Jahreszeichen L folgt die Nummerierung des Regierungsjahrs des betreffenden römischen Kaisers nach griechischen Buchstaben,beispielsweise bedeutet L A die ...
Alexius d'or
Beiname für das 1796 unter Alexius Friedrich Christian von Anhalt-Bernburg geprägte goldene 5-Taler-Stück (Pistole).
Alfonsino
1. Portugiesische Silbermünze, im Verhältnis 3:4 zum portugiesischen Denar unter König Alfons I. (1325-1357) herausgegeben.
2. Der von Alfons I. von Aragon (1416-1458) für seine italienischen Besitzungen Sizilien und Neapel geprägte Typ des Gigliato, der die Fleur de lis zeigt.
Alfonsino d'oro
Beiname der neapolitanischen Goldmünze Ducatone dioro, die unter Alfons I. von Aragon (1416-1458) nach dem Vorbild des französischen Franc d'or à cheval geschlagen wurde.
Alfonso d'oro
Beiname der spanischen Goldmünze zu 25 Pesetas, die schon 1871 eingeführt, aber erst unter König Alfons XII. (1875-1886) in etwas größeren Mengen geprägt wurde.
Alfonso de ouro
Beiname des goldenen portugiesischen Cruzado de ouro unter Alfons V. (1438-1481), der die Goldmünze einführte.
Allegorien
Verbildlichungen abstrakter Begriffe wie Tugend, Ehre, Liebe, Heirat, Glück oder Tod. Bei Allegorien geht es immer darum, ein Thema darzustellen, nicht um die Darstellung einer bestimmten Person wie bei Porträtmedaillen. Allegorische Darstellungen auf Münzen finden sich schon in der Antike, vor allem auf römischen Münzen der späten Kaiserzeit.
Allianzwappen
Heiratswappen
Darstellung von zwei Wappen, die meist eine Verbindung (Allianz) von zwei Ländern oder Fürstentümern – häufig durch Heirat (Heiratswappen) – anzeigen. Dabei steht der ranghöhere Schild, meist der des Ehemannes, heraldisch rechts dem anderen Schild zugewandt. Daneben gab es auch Allianzwappen mit dem Wappen des Bistums (heraldisch rechts) und dem Wappen des geistlichen Würdenträgers (links).
Almohaden
Die islamische Dynastie der Almohaden ging aus einer religiösen Reformbewegung im Nordwesten Afrikas hervor und stürzte 1147 durch Abd al Mumin die Almoraviden in Spanien. Die Almohaden wurden ihrerseits zu Beginn des 13. Jh.s durch die Christen aus Spanien verdrängt und 1269 durch die Meriniden in Marokko gestürzt.
Almoraviden
Maurische Herrscherdynastie, die um 1050 die Herrschaft über das westliche Nordafrika erlangte und 1086 das arabische Spanien unterwarf. Die goldenen Dinare und silbernen Dirhems der Almoraviden verbreiteten sich als Handelsmünzen bis nach Nordeuropa. Von den christlichen Königreichen im Norden Spaniens bedrängt und geschwächt, wurde die Dynastie 1147 von der islamischen Dynastie der Almohaden endgültig gestürzt.
Almosengeld
Münzen oder Marken, die von der Kirche, der Stadt oder dem Fürsten für Arme und Bedürftige ausgegeben wurden und zum Bezug von Nahrung berechtigten, wie z.B. Brotmarken. Sie wurden besonders in Not- und Kriegszeiten, sowie bei Missernten ausgegeben.
Aloetaler
Medaillen aus dem 17. und 18. Jh., die aus Anlass der in Europa noch sehr seltenen Blüte der Aloe mit dem Bild dieser Pflanze versehen wurden.
Altfürsten
Bezeichnung der Fürsten, die im Reichstag zu Augsburg 1582 im Reichsfürstenrat saßen. Dort wurde festgelegt, welche Fürsten zum Reichstag zugelassen wurden (Reichsunmittelbarkeit). Die Stimme im Reichstag wurde an das Territorium geknüpft. Die nach 1582 gefürsteten Häuser wurden als Neufürsten bezeichnet. Die Begriffe kamen im 17. Jh. auf; die Unterscheidung fand ihren Niederschlag in der numismatischen Literatur des 18. Jh.s: Die Münzen der Altfürsten wurden oft getrennt von den neuf
Altilik
Türkische Silbermünze im Wert von 6 Kurush (Piaster), die unter Sultan Mahmud (1808-1839) herausgegeben wurde. 1 Altilik = 4 Altmishlik = 240 Para.
Altun
Türkische Goldmünze, von Sultan Muhammed II. in der Mitte des 15. Jh.s (nach der Eroberung Konstantinopels) nach dem Vorbild des venezianischen Zecchino (Sequino) eingeführt. Dieser Altun zeigt, wie die meisten arabischen Münzen, nur arabische Schriftzeichen. Ein zweiter Typ zeigt seit 1703 die Tughra als Hauptmotiv (Funduk Altun) Der Feingehalt dieser Münze war über die Jahrhunderte konstant und verschlechterte sich erst im 19. Jh.
Altyn
Altynnik
Ursprünglich russische Rechnungseinheit zu 6 Denga, im 14. Jh. aus dem Tatarischen (alty = 6) übernommen. Mit den Münzreformen von Zar Peter dem Großen (1682-1725) wurde der Altyn seit 1698 als Silbermünze im Wert von 3 Kopeken eingeführt. Sie zeigt auf der Vs. den russischen Doppeladler mit Zepter und Globus in den Klauen, seit 1718 den hl. Georg hoch zu Ross. Die Rs.n sind mit dem Datum, der Bezeichnung Altyn oder Altynnik und drei Punkten versehen, die Analphabeten den Umgang m...
Aluminium
Silberweißes Metall mit geringem spezifischem Gewicht, lat. alumen, chemisches Zeichen Al. In der 2. Hälfte des 19. Jh.s begann man Medaillen aus Aluminium herzustellen. In Notzeiten im 20. Jh. in vielen Staaten auch für Münzen benutzt, vor allem im 1. Weltkrieg. Die Gewinnung von Aluminium ist billiger als die der anderen Münzmetalle. Der Nachteil von Aluminium als Münzmetall liegt in der schnelleren Abnutzung; deshalb hat man versucht, durch Legierungen seine technischen Eigenschaften zu...
Aluminium-Bronze
Abgekürzt Al-Bro, chemisches Zeichen Cu-Al, ist ein moderner Münzwerkstoff aus 90-95 % Kupfer und 5-10 % Aluminium; teilweise ist noch Mangan in Spuren zugesetzt (Cu-Al-Mn). Die hell-goldfarbene Legierung ist heute einer der wichtigsten Münzrohstoffe und wird in vielen Staaten verwendet, meist in der Zusammensetzung 92 % Kupfer und 8 % Aluminium, teilweise auch als Bestandteil von Mehrschichtwerkstoffen. Die Vorteile liegen in der Kombination von technischer Eignung, gutem Aussehen und nicht ...
Amadeo d'oro
Goldmünze zu 10 Scudi aus der Regierungszeit des Herzogs Amadeus von Savoyen (1630-1637).
Amani
Afghanische Goldmünze im Wert von einem englischen Pfund. Die Goldmünze wurde nur unter Khan Amanullah (1919-1929) geprägt. Nach der Währungsreform 1926 galt 1 Amani = 20 Afghani. Die Typen zeigen auf der Vs. den Palast mit Thronsaal in einem Stern, seit 1926 das große Nationalemblem. Die Rs. zeigt die Tughra im Lorbeerkranz. Es gab auch Mehrfachwerte (5, 2½ und 2 Amani) und Halbstücke. Eine Besonderheit ist die Datierung der Goldstücke nach dem Sonnenjahr (SH), denn im Jahr 1920 ließ d...
Ambrosino
Beiname verschiedener mailändischer Münzen aus dem Spätmittelalter, nach den Münzbildern des bedeutenden Kirchenlehrers Ambrosius (374-397 Bischof von Mailand) benannt:
1. Die Ambrosini d'argento wurden zwischen dem 13. und 15. Jh. zu 1½ Soldo geprägt. In der 2. Hälfte des 15. Jh.s ging der Name auf eine Groschenmünze zu einem Soldo über.
2. Der Ambrosino d'oro, eine nach dem Vorbild des florentinischen Fiorino geprägte Goldmünze aus der 2. Hälfte des 13. Jh.s, zeigt auf der Rücksei...
Ameisennasenmünzen
Bezeichnung für kleine, gegossene Bronzestücke, die zur Zeit der Chou-Dynastie (11.-3. Jh. v. Chr.), die im Süden Chinas als Tausch- und Zahlungsmittel und als religiös-kultische Objekte (Totengeld) dienten. Da die späten Stücke des Ameisennasengelds in ihrer äußeren rund-ovalen Form dem verkleinerten (Kümmerformen) Gehäuse einer Kaurischnecke ähnelten, zählt man sie auch zu den Kaurigeld-Imitationen, die auch aus Stein, Knochen, Kupfer oder Messing hergestellt wurden. Den Grund für...
Ammon
Ursprünglich eine libysche Gottheit, die vermutlich als Beschützer und Führer von Herden verehrt wurde. In Ägypten, Syrien und Griechenland erscheint Ammon in Synkretismus mit Ra, Baal und Zeus. Der Ammon-Kult ging von Karnak aus, später vom Heiligtum und Orakel in der Oase Siwa. Beim Besuch des Heiligtums in der Oase wurde Alexander der Große als Sohn des Ammon-Ra (Gott-König) begrüßt, ein einschneidendes Ereignis für die spätere hellenistische und römische Münzprägung (Apotheose ...
Amoli
Bezeichnung von Salzgeld aus gelblich-grauen, ungereinigten Salzblöcken, das traditionell in Äthiopien und Eritrea als universales Zahlungsmittel über Jahrhunderte in Umlauf war. Die zum Naturalgeld zählenden, standardisierten Salzbarren schwanken im Gewicht zwischen 650 und 950 g. Die quaderförmigen Barren messen etwa 26-30 x 5 x 4 cm und sind ähnlich wie ein Kastenbrot gestaltet. Um das Zerbröseln oder Zerbrechen der Barren zu verhindern, sind sie mit den für Amolis charakteristischen ...
Amulettmünzen
Meist als Anhänger getragene, gelochte oder gefasste Münzen oder Medaillen, deren Funktion darin bestand, vor Krankheiten, Gefahren, Dämonen, dem "bösen Blick" oder sonstigem Unheil zu schützen und auch Glück, Reichtum, körperliche oder geistige Unversehrtheit zu bringen oder bewahren zu können. Die Darstellungen und Inschriften der Amulettmünzen hatten meist religiösen Charakter. Neben Spezialanfertigungen und Kleinmünzen vorwiegend religiöser Münzherren mit Christus- oder Heiligen...
ANA
Abkürzung für American Numismatic Association, dem 1891 gegründeten, weltweit größten Verband für Münzsammler.
Anatomia in Nummis
Bezeichnung eines Sammelbereichs von Münzen und Medaillen, der sich auf Darstellungen von anatomischen und chirurgischen Motiven und auf Ärzte aus diesem medizinischen Bereich bezieht. Es handelt sich um ein Untergebiet des umfangreichen Sammelgebiets Medicina in Nummis.
Anchor Money
Ankergeld
Sammelbezeichnung für britische Kolonialmünzen aus Silber, benannt nach dem Rückseitenbild, einem gekrönten Anker (engl. anchor) unter der britischen Krone. Die Vs.n zeigen den geschweiften, ornamentierten Wappenschild von Großbritannien (und Hannover). Anchor Money wurde nur zwischen 1820 und 1822 in Werten zu 1/2, 1/4, 1/8 und 1/16 des spanisch-mexikanischen Pesos (Piaster) für Ceylon und für die British-Westindies (Bahamas) geprägt. Die Münzen wurden nicht im Standard von S...
Anconetano
Groschenmünze zu einem Soldo aus dem 13. Jh., in der Stadtrepublik Ancona geprägt.
Andreas-Hofer-Kreuzer
Bezeichnung für die 1-Kreuzer-Kupfermünzen und die 20-Kreuzer-Silbermünzen (Sandwirtszwanziger). Sie wurden während des von dem Sandwirt Andreas Hofer angeführten Tiroler Aufstands 1809 in der Münzstätte Hall geprägt.
Andreasmünzen
Andriesgulden, Andreastaler
Sammelbezeichnung für Münzen mit Darstellungen des Apostels Andreas und des nach ihm benannten X-förmigen Balkenkreuzes als Attribut. Die ältesten Andreasmünzen sind die 1467-1477 in Brabant geprägten goldenen Andriesgulden zu je 20 Stüber, die auch 1477-1482 unter Herzogin Maria von Burgund als Florin de Bourgogne ausgebracht wurden. Die bekanntesten sind jedoch die Andreastaler, deren Silber ursprünglich aus der Andreasgrube im Harz gefördert wurde. Zuerst ...
Ange d'or
Mittelalterliche französische Goldmünze, unter König Philipp VI. zu 75 Sols tournois ausgegeben. Die Goldmünze ist nach dem auf dem Münzbild dargestellten Erzengel Michael benannt (Ange d'or = goldener Engel). Philipp der Kühne von Flandern ließ 1387 einen Ange d'or (Gouden Engel) mit 2 Wappenschilden schlagen, den die Herzogin Johanna von Brabant (1383-1406) mit einem Schild nachahmte. Auch Wilhelm IV. gab in Hennegau einen Ange d'or aus, der nach der Darstellung einer Umfiedung (Zaun) a...
Angel
Englische Goldmünze, die im Jahr 1465 als Nachfolger des Nobel in der ersten Regierungszeit Edwards IV. (1461-1470) eingeführt und unter den konkurrierenden Häusern von York und Lancaster während der Rosenkriege (1455-1485) geprägt wurde. Der Angel wurde ursprünglich mit 6 Shilling 8 Pence bewertet, sein Wert stieg aber bald auf 10 Shilling. Die Goldmünze hat ihren Namen von dem Erzengel Michael, der auf der Vs. als Drachentöter dargestellt ist. Die Rs. zeigt ein Schiff mit Wappen belegt...
Angelet
Der Ausdruck ist eine Verkleinerungsform des englischen Wortes Angel (etwa Engelchen) und bezeichnet das Halbstück des Angel. Der Typ ist der gleiche wie der des Ganzstückes, aber der Angelet ist seltener und deshalb heute für den Sammler oft kostspieliger als der Angel.
Angelhakengeld
Die zutreffender als Larin bezeichneten Zahlungsmittel, die am Persischen Golf und im Küstengebiet Indiens benutzt wurden, werden aufgrund der Hakenform als Angelhakengeld bezeichnet. Tatsächliches Angelhakengeld aus Schildpatt, dem Gehäuse von Muscheln und Schnecken sowie aus Knochen soll auf denMarschall- und Gilbert-Inseln in Umlauf gewesen sein. Eskimos in Alaska und Kanada sollen stählerne Angelhaken als Zahlungsmittel genutzt haben.
Angelot
Anglo-gallische Goldmünze im Wert von 15 Sols tournois, unter Heinrich VI. von England während des Hundertjährigen Kriegs 1427 in einigen Münzstätten Frankreichs ausgeprägt. Sie zeigt auf der Vs. den Erzengel Gabriel, der seine Flügel über die Wappen von Frankreich und England ausbreitet. Die Rs. zeigt das lateinische Kreuz (der senkrechte Balken ist größer als der waagrechte) zwischen der französischen Fleur de lis (Lilienblüte) und dem englischen Leoparden. Unter König Ludwig XI. ...
Angevin
Nach der Münzstätte Angers benannter französischer Silberdenar (Denier) der Grafen von Anjou, ursprünglich im Wert eines Denier tournois. Er wurde von 987 n. Chr. bis zum Ende des 13. Jh.s geprägt. Der Angevin sank im 11. Jh. im Wert, sodass er den halben Wert des in der benachbarten Grafschaft Maine (seit 1110 zu Anjou gehörend) geschlagenen Mansois darstellte. Im 14. Jh. wurde eine kleine Billonmünze zu einem Vierteldenar aus Metz mit diesem Namen belegt.
Angliana
Silbermünze im Wert von einer Rupie, von der britischen Handelskompanie East India Company ab 1672 in Bombay herausgegeben, auch Anglina genannt.
Angrogne
Engrogne, Anserna
Bezeichnung eines Denars der Grafschaft Burgund im Wert von 1/12 Gros tournois (Turnosegroschen), im Jahr 1256 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Im Laufe des 16. Jh.s verschwindet die Bezeichnung Angrogne wieder. In den französischsprachigen Urkunden wird die Münze meist Engrogne, latinisiert auchAnsarna oder Ancerna genannt.
Angster
Schweizer Kleinsilbermünzen, ursprünglich Mitte des 14. Jh.s als Basler viereckige Hohlpfennige geprägt. Die Angster verbreiteten sich über die ganze Schweiz und bestanden in verschiedenen Ausprägungen, meist im Wert von ½ Rappen, bis zur Einführung der Frankenwährung 1850. Der Name leitet sich vermutlich vom lateinischen Wort angustus ab, das eng, klein, dünn bedeutet.
Angster, geprägt unter Johann III. v. Vienne Bischof von Basel (1355-1382)
Angsttaler
Sammlerbezeichnung für eine Talermünze von 1848, auf der die sonst in der Münzumschrift üblichen Buchstaben V.G.G. (Von Gottes Gnaden) fehlen. Angeblich soll Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin aus Angst vor den revolutionären Unruhen des Jahres den Hinweis auf das Gottesgnadentum weggelassen haben. Jedoch hat sein Vorläufer, Großherzog Paul Friedrich (1837-1842), der allerdings keine Taler prägen ließ, auf anderen Nominalen auch schon auf besagten Hinweis verzichte...
Anima
Lat. Wort für Seele, bezeichnet im numismatischen Zusammenhang den Kern gefütterter Münzen, der aus unedlen Metallen bestand. Wenn der Edelmetallüberzug der gefütterten Münzen beschädigt war, konnte die Anima dort herausoxidieren, sodass nur die leere Hülle zurückblieb. Siehe auch subaerat.
Anna
Alte indische Münze, später im Wert von 1/16 der indisch-britischen Rupie. Zur Kolonialzeit gab die East India Company, später Britisch-Indien Annas aus Kupfer-Nickel aus. 1 Anna = 4 Paisa = 12 Pie. Es gab auch kupferne Halb- und Viertelstücke sowie Doppelstücke aus Silber. Mit dem Aufbau des Dezimalsystems 1957 verschwand die Anna aus dem indischen Münzsystem. In Pakistan hielt sie sich bis 1960. In Oman und Maskat galt 1 Anna = 4 Baisa (bis 1946).
Annataler
Talermünzen der Grafen Schlick im 17. und 18. Jh.. Die Münze ist nach der Abbildung auf der Vs. benannt, dem Motiv der Anna Selbtritt, die heilige Anna mit je einem Kind (Maria und Christus) im Arm.
Annengroschen
Niedersächsische Groschenmünzen, die nach dem Hildesheimer Münzvertrag in Hildesheim und Hannover 1501, in Braunschweig von 1533 bis 1541 ausgegeben wurden. Der Annengroschen hat seinen Namen von der Darstellung der Anna Selbtritt auf dem Münzbild. 12 Annengroschen sollten einen Goldgulden gelten.
Annona
Römische Personifikation des Jahresertrags oder der Ernte, hauptsächlich von Getreide, und auch Schutzgöttin der Verschiffung der Ernte nach Rom. Annona, vom lateinischen Wort annus = Jahr herzuleiten, erscheint auf römischen Münzen der Kaiser Nero (54-68 n. Chr.) bis Carus (282-283 n. Chr.) als weibliche Gestalt mit den Attributen Ährenbündel, Modius (Getreidescheffel), Füllhorn oder Fruchtkorb als Symbol der Ernte, Schiff, Steuer oder Anker als Symbole für die Verschiffung der Ernte. ...
Annunciata
Silbermünze der Fürsten Gonzaga aus Guastalla aus dem 16. Jh. zu 14 Soldi. Der Münzname leitet sich aus der Darstellung der Verkündigung Mariäs auf der Rückseite der Münze ab. Nach diesem Motiv und mit gleicher Benennung wurde zwischen 1743 und 1746 in Savoyen auch eine Zecchine geprägt. Es gab auch und Halb- und Vierfachstücke.
Anselmino
Silbermünze zu 20 Soldi, unter Vincenz Gonzaga (1587-1612) in Mantua mit dem Schutzpatron der Stadt, dem heiligen Anselm, auf der Münzvorderseite geprägt.
Anthony Dollar
Kurzlebige Dollarmünze (1979-1981) mit dem Bildnis der Frauenrechtlerin Susan B. Anthony (1820-1906). Zum ersten Mal zeigte eine für den Umlauf bestimmte Münze der USA das Bildnis einer amerikanischen Frau. Die Rs. zeigt den vom Eisenhower-Dollar übernommenen Weißkopfseeadler, der – in den Fängen einen Ölzweig – auf dem Mond landet; am Mondhimmel die Erde. Die Darstellung ist dem Emblem des Raumschiffs Apollo 11 nachempfunden, mit dem am 20.7.1969 zum ersten Mal Menschen auf dem Mond ...
Antike
Der Begriff Antike als historische Zeitepoche bildete sich erst im 19. Jh. heraus. Seitdem wird das 6. vorchristliche Jh. bis zum Ende des weströmischen Reichs (476 n. Chr.) als Antike angesehen. Das gilt aber nur für die abendländische Kultur, denn der Versuch Spenglers, den Begriff auch auf Frühformen anderer Kulturkreise anzuwenden, hat sich nicht durchgesetzt. In der Antike hat sich nicht nur die Philosophie entwickelt, sondern auch die wissenschaftlichen Disziplinen Mathematik, Medizin,...
Antike Münzen
Die numismatische Grobeinteilung in Antike, Mittelalter und Neuzeit hat – trotz aller Probleme historischer Periodisierung – immer noch Bestand, zumindest für den europäischen Kulturkreis. In der Antike, die als Wiege unserer Kultur gilt, wurde die Münze mit figürlichen Darstellungen und festgelegten Gewichtsstandards von den Griechen überhaupt erst erfunden. Die erste Stufe der Entwicklung geht im 7.Jh. v. Chr. vom Bereich Lydien-Ionien aus. Das beweisen die Funde aus Ephesos, auch wen...
Antimon
Lat. Stibium, chem. Zeichen Sb., ist ein silberweißes, sprödes Halbmetall, das 1931 in der chinesischen Provinz Kweichow für das 10-Cent-Stück als Münzwerkstoff verwendet wurde.
Antinous-Münzen
Antike Gepräge, die das Bildnis des Antinous (griech. Antinoos) tragen, der um 110 n. Chr. in Bithynien (Kleinasien) geboren wurde. Als Jüngling wurde er zum Favoriten und ständigen Begleiter des römischen Kaisers Hadrian (117-138 n. Chr.). Auf einer Ägyptenreise, auf der er um 130 n. Chr. Hadrian begleitete, ertrank er unter ungeklärten Umständen in den Fluten des Niles. Nach der Legende hatte der Jüngling die ersten Zeichen des Alters auf seinen Zügen entdeckt oder wollte sich für da...
Antireformationstaler
Gegenreformationstaler
Auch als Gegenreformationstaler bezeichnete Silbermünzen des Grafen Anton III. von Montfort aus dem Jahr 1730. Die Vorderseite des Talers zeigt den heiligen Johann von Montfort, die Rückseite die Aussendung des Heiligen Geistes zur heiligen Jungfrau mit der Umschrift: DVRCH GOTT VNTER MARIAE SCHVTZ WVRDT DIS GEDRVCKHT DEM FEINDT ZVM TRVTZ. Die Münzelässt sich als Gegenreaktion des Grafen auf die vielen evangelischen Gedenkprägungen zum 200. Jahrestag des Augsburger Be...
Antizipationsscheine
Österreichische Papiergeldemissionen von 1813 zur Deckung der Kosten der Napoleonischen Kriege. Die von der Wiener Stadt-Banco ungehemmtherausgegebenen Bankozettel wurden nach dem Staatsbankrott 1811 von Einlösungsscheinen ersetzt, deren Menge begrenzt wurde. Um diese Verpflichtung zu umgehen, wurden von der „Privilegierten Vereinigten Einlösungs- und Tilgungsdeputation“ Antizipationsscheine zu 2, 5, 10 und 20 Gulden ausgegeben, die durch die Vorwegnahme künftiger Staatseinkünfte gedeck...
Anton d'or
Goldene 5-Taler-Stücke (Pistolen) des sächsischen Königs Anton Klemens Theodor (1827-1836). Sie zeigen auf der Vs. den Kopf des Herrschers mit der Umschrift ANTON V. G. G. (Von Gottes Gnaden) KOENIG VON SACHSEN, auf der Rs. das bekrönte Landesschild mit Wertangabe und Jahreszahl. Es gab auch Doppelstücke.
Antoninian
Antike Silbermünze des 3. Jh.s, die unter Kaiser Caracalla (198-217 n. Chr.) im Jahr 214 n. Chr. eingeführt wurde. Der Name ist erst seit dem Mittelalter geläufig, nach dem eigentlichen Kaisernamen Caracallas, Marcus Aurelius Antoninus. Das Erkennungszeichen der Münze ist die Strahlenkrone des Kaisers bzw. die Mondsichel (Lunula) der Kaiserin, zukünftig die Erkennungszeichen für den Großteil der spätrömischen Doppelstücke. Beim ursprünglichen Antoninian handelte es sich um einen gutha...
Antoniustaler
Talermünzen, deren Silber von 1697-1701 aus der St. Antoniusgrube im Harz ausgebeutet wurde (Ausbeutemünzen). Die unter dem Hildesheimer Bischof Jobst Edmund von Brabeck (1688-1702) geprägten Münzen zeigen den heiligen Antonius auf ihrer Rückseite.
Antrittsmünze
Gedenkprägungen aus Anlass eines Regierungsantritts, Krönungs- und Huldigungsmünzen, wie z.B. die mexikanischen Proklamationsmünzen zum Regierungsantritt des spanischen Königs Karl IV. 1789 in Mexiko. Sie wurden in Werten zwischen ½ Real und 8 Reales geprägt und zeigen auf den Vs.n zwischen den beiden Säulen des Herakles das bekrönte Wappen, auf den Rs.n die Schrift PROCLAMA/DO EN MEXI/CO ANO DE 1789, darunter den Wert.
Apex
Römischer Kultgegenstand in Form eines Olivenholzstäbchens, das mit einem Wollfaden umwickelt und von einer Art Wollbüschel gekrönt war. Als Insignium der Priesterwürde der Flamines und Salier wurde es an der Spitze ihrer Mütze getragen und ist auf römischen Münzen dargestellt.
Apfelgroschen
Reichsgroschen
Deutsche Groschenmünzen, als Nachfolger der Fürstengroschen um 1570 eingeführt. Auf einen Reichstaler entfielen ursprünglich 24 Apfelgroschen, aufgrund des sinkenden Feingehalts der Kleinmünzen stieg der Wert des Talers in Groschen aber beständig an. Ihren Namen bekamen sie von der Darstellung des Reichsapfels mit der eingeschriebenen Wertzahl 24 auf der Münzrückseite, deshalb auch Reichsgroschen genannt. Da die Apfelgroschen (12 Pfennige) höher bewertet wurden als die Ma...
Apfelgulden
Deutsche Goldgulden des 15. und 16. Jh.s mit einem Apfel im Dreipass auf der Münzrückseite. Sie wurden vorwiegend von Pächtern der kaiserlichen Münzstätten Basel, Nördlingen und Frankfurt am Main geprägt.
Aphlaston
Die Heckzier antiker Schiffe, die aus mehreren gebogenen Holzleisten bestand und in der Antike religiös-kultische Bedeutung genoss und als Siegestrophäe nach Seeschlachten begehrt war. Aphlasta waren vor allem in bedeutenden Seestädten beliebt und sind auf antiken griechischen Münzen der Städte Lipara, Kerkyra und Phaselis dargestellt. Als Beizeichen kommen sie auf Münzen von Korinth und Tarent vor. Auch der Meeresgott Poseidon (Neptun), die Siegesgöttin Nike und der als Stadtgottheit von...
Aphrodite
Die griechische Göttin der (sinnlichen) Liebe und (betörenden) Schönheit zählt zu den zwölf großen olympischen Gottheiten. Ihre Herkunft aus dem Orient ist gesichert; darauf weist auch ihre Geburt aus dem Schaum des Meeres hin, von dem sich ihr Name(griech. = Schaum) ableitet. Auf griechischen und provinzialrömischen Münzen ist sie sehr häufig als Kopfbild, Büste oder als Ganzfigur dargestellt, letztere zeigt sie oft nackt oder leicht bekleidet. Gelegentlich ist ihr Eros beigestellt, d...
Apis
Als Gott verehrter heiliger Stier der Ägypter, in Memphis als Erscheinungsform des Stadtgottes Ptah verehrt. Er lebt im Apieion, wo er sich Gläubigen zeigt (Orakel). Aus Oserapis (aus Osiris und Apis gebildet) - das sind alle toten Apisstiere - entwickelt sich die Gottheit Serapis. Die Griechen setzen ihn mit Epaphos gleich, später mit Isis. In Gestalt eines Stiers erscheint Apis (Serapis) auf Münzen von Memphis, ebenso auf alexandrinischen römischen Münzen sowie auf städtischen Prägunge...
Apollon
Auch Apoll oder Apollo, ist der griechisch-römische Licht- und Sonnengott (Beiname „Phoibos“ oder „Phöbus“), der Gott der Weissagung („Pythios“ als Orakelgott von Delphi), der Wissenschaft und Künste („Muagetes“ als Musenführer), vor allem der Musik. Die Römer haben die Gottheit von den Griechen vor allem in seiner Funktion als Heilgott (Paieon, Medicus) und Sonnengott (Re, Helios, Apollon) übernommen. Apollon fungierte auch als Schutzpatron des Hauses, der Familie und der ...
Aposteltaler
Beiname einer Schaumünze Kaiser Rudolfs II. (1576-1612), die nach der Darstellung der 12 Apostel auf der Rückseite der Münze benannt ist.
Apotheose
Vergöttlichung eines Menschen, Erhebung eines Sterblichen in den Rang eines Unsterblichen. Der römische Brauch, Kaiser und Kaiserin posthum zu Göttern zu erheben, findet seinen Ausdruck in der offiziellen Verleihung der Titel Divus bzw. Diva durch den Senat. Dem entsprach der Brauch, bei der zeremoniellen Verbrennung der Verstorbenen einen Adler freizulassen, der die Seele des Kaisers oder der Kaiserin in das Reich der Götter bringen sollte. Der römische Kaiserkult fand numismatisch seinen ...
Apulienser
Bezeichnung für sizilianische und süditalienische Denare des 12. Jh.s, auch als Drittel- und Sechsteldukaten geschlagen. Wilhelm II., der seit dem 14. Mai 1166 König von Neapel und Sizilien war, ließ Apulienser im Gewicht von etwa 2,6 bis 2,7 g und Tercenarii in Palermo schlagen, teils in konkaver Form, teils mit kufischen Aufschriften. Kaiser Heinrich VI. und seine Gemahlin Konstanze ließen 1195 in Brindisi einen "denarius apuliensis imperalis" im Gewicht von etwa 1 g schlagen.
Arbitrage
Auffinden des vorteilhaftesten Weges, eine Zahlung im Ausland zu leisten oder eine Geldsorte zu erhalten. Man unterscheidet Edelmetall-, Sorten-, Wechsel-, Diskont-, Geld- und Aktien-Arbitrage. Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet wörtlich Vergleich.
Ardite
Katalanische Scheidemünze des 17. Jh.s zu 2 Dineros, vermutlich vom französischen Münznominal Hardi abgeleitet. Die Libra de Ardites war noch bis in die Mitte des 19. Jh.s Rechnungsmünze zu 20 Sueldos.
Arend-Rijksdaalder
Niederländische Talermünze (Adlerreichstaler) mit dem Reichsadler auf dem Münzbild, 1583/84 in Friesland, später auch in Deventer, Zwolle, Nijmwegen und Campen herausgegeben. Der Arend-Rijksdaalder hat ein Raugewicht von 29,03 g (885/1000 fein) und kann leicht mit dem Arendsdaalder verwechselt werden, der aber nur ein Raugewicht von 20,68 g (750/1000 fein) hat.
Arendschelling
Krabbelaer
Auch Escalin, ist eine niederländische Silber- oder Billonmünze (Adlerschilling) zu 6 Stuiver, nach der Darstellung des gekrönten doppelköpfigen Reichsadlers auf der Rs. benannt. Die Rs.n sind seit Rudolph II. (1576-1612) mit den Titeln der Kaiser beschriftet, die Vs.n zeigen meist bekrönte Wappen. Sie wurden in der 2. Hälfte des 16. Jh.s in verschiedenen Städten und Regionen der Niederlande (u.a. Kampen, Nijmegen, Zwolle) im Gewicht von etwa 6 g (ca. 500/1000 fein) eingeführt...
Arendsdaalder
Talermünze (Adlertaler) mit der Darstellung des Reichsadlers, die in den niederländischen Provinzen Seeland 1602 (auch in Teilstücken) und Friesland 1617 (nur als ganze Stücke) herausgebracht wurden. 1 Arendsdaalder = 60 Groot = 30 Stuiver. Gewichtsangabe: Arend-Rijksdaalder.
Arenkopf
Hahnenkopf, Arnekopf
Beiname kleiner Hohlpfennige der Stadt Goslar (Gosler) zu einem Schärf oder einem halben Pfennig aus dem 15. Jh. Nach dem Münzbild (Adler) auch Arnekopf und Hahnenkopf genannt.
Arensgulden
Rechenbegriff von 15, vereinzelt auch von 16 Krummsteert in Ostfriesland. Der Name geht vermutlich auf den Arnheimer Gulden zurück, der wohl vorübergehend diesen Kurs hielt, an dem die Bevölkerung festhielt.
Ares
Griechischer Kriegsgott thrakischer Herkunft, Sohn des Zeus und der Hera, ist einer der zwölf großen olympischen Götter. Trotzdem verlieh ihm Homer eher unsympathische, barbarische Züge. Statt eine Stadt zu beschützen, Kampfgeist zu verleihen oder den Krieg weise zu planen, wechselt er, je nach Kampfeslust, die Seiten und gleicht einem wilden, mordlustigen Raufbold. Diese negativen Seiten gehen nicht auf seine römische Entsprechung Mars über. Ares kann von den Göttern bestraft und gedem
Arethusa
Nymphe, die nach der antiken Sage vor ihrem Verfolger, dem Flussgott Alpheios, entfloh. Mit Hilfe der Göttin Artemis, die sie in einen Wasserstrom verwandelte, floss sie unter dem Ionischen Meer von Griechenland (Peloponnes) nach Sizilien und tauchte auf der Insel Ortygia, dem Kernland von Syrakus, wieder auf. Das Kopfbild der Arethusa in Assimilation mit Artemis (Artemis-Arethusa), umkreist von vier Delfinen, ist das wichtigste Münzbild der antiken Münzen von Syrakus im 5. Jh. und zu Anfang ...
Argent-Le-Roi
Französische Bezeichnung für Silber (wörtlich: Königssilber) mit einem Feingehalt von 958/1000, was einem Anteil von 23/24 Silber mit einem Zusatz von 1/24 Kupfer entspricht. Im mittelalterlichen Frankreich galt das Argent-Le-Roi als reines Silber (Feinsilber).
Argenteus
Römische Silbereinheitsmünze, die im Rahmen der Münzreform des Kaisers Diokletian (294-305 n. Chr.) um 294 n. Chr. eingeführt wurde. Ihr Gewicht sollte 1/96 (römisches) Pfund betragen, also 3,41 g, die meisten Stücke kommen aber untergewichtig vor. Kaiser Konstantin der Große ließ sie 320 n. Chr. durch die Siliqua ersetzen. 1 Argenteus = 8 Folles, 1 Aureus = 25 Argentei.
Argenteus des Maximianus
Argentino
Argentinische Goldmünze zu 5 Pesos, die als Äquivalent des 25-Francs-Stücks der Lateinischen Münzunion von 1881 bis 1889 und 1896 in großen Mengen geprägt wurde. Die Halbstücke (2½ Pesos) wurden 1881 als Muster (nur 9 Stück) und 1884 ausgegeben, in wesentlich geringeren Mengen als die Ganzstücke.
Ariary
Münzeinheit im Wert von 5 Madagaskar-Francs. Bis zum Austritt Madagaskars aus der Franc-Währungszone 1973 tauchten beide Bezeichnungen, also 5 Francs und 1 Ariary auf demselben Münznominal auf, danach nur noch Ariary.
Armellino
Groschenmünze zu einem halben Carlino, Ferdinand I., 1458-1494 König von Neapel, mit der Gründung des Hermelinordens im Jahr 1464 einführte. Das dem Wappen des Ritterordens zum Hermelin entnommene Münzbild gab der Silbermünze ihren Namen.
Arnaldenses
Lat. Bezeichnung der Denare des französischen Bistums Agen, die zwischen dem 11. und 14. Jh. im Umlauf waren.
Arnoldsgulden
Nach Arnold von Egmont (1423-1473), dem Herzog von Geldern, benannte minderwertige Goldgulden. Wegen ihres geringen Feingewichts wurden sie nur mit 10½ Stuivern bewertet (der vollwertige rheinische Gulden galt vergleichsweise 20 Stuiver).
Arsakiden
Persische Herrscherdynastie der Parther, benannt nach ihrem Gründer Arsakes I., der zwischen 250 und 238 v. Chr. die Seleukiden aus der Parthava (Persien) vertrieb. Unter Mithridiates I. (etwa 171-139 v. Chr.) eroberten die Parther fast ganz Mesopotamien. Danach wurde das Partherreich durch Nomaden aus Zentralasien bedroht, durch die Kriege mit den Römern geschwächt und schließlich durch die Sassaniden gestürzt.
Artemis
Griechische Göttin der Jagd, des Tierreichs und des Mondes. Sie gilt als Beschützerin der Jugend und der Tugend, in Sykretismus mit einer alten Gottheit aus Kleinasien auch als Göttin der Fruchtbarkeit (vor allem in Ephesos). Die Zwillingsschwester des Apollon ist auf vielen antiken griechischen und römischen Münzen mit Pfeil und Bogen in Begleitung von Nymphen oder Tieren dargestellt. Auf den antiken Münzen der bedeutenden sizilischen Stadt Syrakus aus dem 5./ frühen 4. Jh. sind die beso...
Artig
Baltische Kleinmünze, im 14. und 15. Jh. im Bistum Dorpat, im Erzbistum Riga und vom livländischen Schwertbrüderorden geprägt. Die Bezeichnung leitet sich vermutlich vom schwedischen Örtug ab. Je nach Münzfuß lag der Wert der Artiger zwischen einem Pfennig und einem Schilling.
Artiluk
Dreigroschenmünze der Stadt Ragusa (Dubrovnik), von 1627 bis 1701 im Wert von 6 türkischen Para geprägt. Die Münze erhielt ihren Namen vielleicht nach dem türkischen Wort „altiluk“ für Sechser.
Artukidenmünzen
Ortukiden
Bezeichnung der Münzen der Artukiden-Dynastie (auch Ortuqiden oder Ortokiden), einer Herrscherlinie sunnitischer Turkmenen, die im Mittelalter in Mesopotamien eine kulturelle Blüte erreichte, trotz ihrer halbnomadischen Herkunft. Sie errichteten kulturelle Zentren in Hasankeyf, Diyarbakir, Harput und (seit dem 12. Jh.) in Mardin, im Gebiet der heutigen Südost-Türkei. Die Benennung der Dynastie geht auf den Begründer Artuq ibn Aksab zurück, der für seine militärischen Verdienste...
As
1. Antike römische Gewichts- und Münzeinheit. Die Römer nannten die ungeteilte metrische Grundeinheit As („das ungeteilte Ganze“). Das Wort ist im Kartenspiel erhalten geblieben. Der gegossene As im Gewicht der römischen Gewichtseinheit Libra (Pfund), auch librales As (lat. As librarius) genannt, stellt die „Urmünze“ der Römer dar. Der librale As war die Münzeinheit der ursprünglichen Aes-grave-Reihen, die von den Römern etwa seit 269 v. Chr. gegossen wurden. Der As des römisch...
Ashrafi
Bezeichnung einer Goldmünze, die vom 15. Jh. bis in die 30er Jahre des 18. Jh.s in Persien im Umlauf war. Ihr Wert entsprach in etwa einem venezianischen Zecchino. Auch in einigen indischen Staaten und Afghanistan waren Ashrafis im Umlauf. Die Goldmünze wurde in den meisten Ländern vom Mohur abgelöst.
Ashrafi geprägt unter Shah Mohamed Khodabarde (1578-1588 n. Chr.)
Asklepios
Griechischer Heilgott, der erst im 5. Jh. v. Chr. eine große Bedeutung erlangt und dann bis in die Spätantike zu den populärsten Göttern der griechischen Welt zählt. Vermutlich war er ursprünglich erst ein Heros von lokaler Bedeutung in Thessalien. Von seiner Hauptkultstätte Epidauros gingen Tochterkulte aus, u.a. in Athen und Pergamon. Bereits im beginnenden 3. Jh. v. Chr. haben die Römer Asklepios als Aesculap übernommen. Darstellungen zeigen Asklepios als reifen Mann, oft an einen St...
Asper
Standard-Silbermünze der Komnenen von Trapezunt (1204-1461), ursprünglich im Gewicht von 2,9 g, das aber im Lauf der Zeit abnahm. Ihr Münzfuß war nach dem zeitgleich ausgegebenen Dirham der benachbarten Seldschuken ausgerichtet, seine Größe und Prägung zeigt Ähnlichkeit mit dem leichteren venezianischen Grosso. Das Münzbild zeigt avers die Darstellung der Kaiser, reitend oder stehend, revers den Trapezunter Schutzpatron St. Eugenius mit Langkreuz. Das Münzbild ist durch eine Fülle von...
Aspergillum
Römisches Pontifikalgerät, eine Art Wedel, der bei Weihungen zum Besprengen des geweihten Gegenstands mit Wasser diente. Das Aspergillum ist auf römischen Münzen als Beizeichen eines Mitglieds der Kaiserfamilie zu sehen, wenn seine Zugehörigkeit zu einem Priesterkollegium gefeiert wurde.
Aspron trachy
Byzantinische Münzbezeichnung in der Bedeutung „weiße schüsselförmige Münze“. Kaiser Alexios I. Komnenos (1081-1118 n. Chr.) reformierte 1092 das zerrüttete byzantinische Münzwesen. Im Rahmen der Reform wurde die Standardgoldmünze Hyperpyron, der Aspron trachy aus Elektron (1/3 Hyperpyron) und eine Billonmünze (1/48 Hyperpyron) eingeführt, die ebenfalls Aspron trachy genannt wurde. Beide Münzen sehen schüsselförmig aus. Sie wirkten neugeprägt silbrig-weiß, heute haben die Bill...
Assarion
Griechische Bezeichnung für das römische As. Die Bezeichnung geht auf Prägungen kleinasiatischer Provinzen in der römischen Kaiserzeit zurück. Diese eigenen Prägungen konnten sowohl nach dem geltenden römischen wie auch nach eigenem Münzfuß herausgebracht werden.
Assignaten
Französisches Papiergeld aus der Zeit der Französischen Revolution (franz. l'assignation = Anweisung). Um das Haushaltsdefizit zu decken, beschloss die Nationalversammlung im Jahr 1789, verzinsliche Anleihen auf den zu erwartenden Verkaufserlös der beschlagnahmten Kirchengüter auszugeben. Die folgenden Emissionen der Assignaten waren unverzinslich und wurden schließlich so zahlreich ausgegeben, dass sie 1792 zum alleinigen Zahlungsmittel wurden. Durch Inflation verfiel ihr Wert drastisch, s...
Assis
Straßburger Groschenmünze zu 6 Kreuzern, vom 16. bis zum 18. Jh. geprägt. Das Halbstück wird als Semissis, das häufig geprägte Doppelstück als Assis Douplex bezeichnet. Der Assis wurde zu Beginn des 18. Jh. von Basel und Oberwalden nachgemünzt.
Astragal
Anatomisch gesehen der Gelenkknöchel an der Ferse des Fußes (Sprunggelenk). Der als magisch betrachtete Gelenkknochen von Hammel, Schaf oder Widder fand in der Antike auch als vierseitiger Würfel für das profane Knöchelspiel Verwendung. Bronzenachbildungen des Astragal dienten als Münzgewichte. Als Münzbild erscheint er meist als Beizeichen, auf verschiedenen Unciae der römischen Republik auch als Ganzbild.
Astrologie
Die Kunst, aus den Erscheinungsformen und Stellungen der Gestirne (Makrokosmos) Naturereignisse und Charaktereigenschaften zu deuten oder vorauszusagen, die das Schicksal und die Zukunft sowohl von ganzen Völkern, wie auch von einzelnen Menschen (Mikrokosmos) betreffen. Die Astrologie wurde im Altertum von altorientalischen Kulturen, insbesondere von den Babyloniern, übernommen. Schon früh wurden Sternbilder, Sterne und Planeten mit den Namen von Göttern und Helden versehen und mit bestimmte...
Athene
Griechische Göttin der Weisheit, der Kunst und des Handwerks (z.B. der Töpfer), vor allem aber wehrhafte Beschützerin Attikas, insbesondere der Stadt Athen, des Hauses, der Burg und der Landwirtschaft Athens. Ihre römische Entsprechung ist Minerva. Auf antiken Münzen, insbesondere den Eulen von Athen, sehr häufig als junge Frau (Pallas) mit Helm und Waffen dargestellt.
Att
Siamesische Kupfermünze bis 1905. 1 Tikal = 64 Att und mit demselben Wert bis 1859 auch in Kambodscha im Umlauf. Att wurde als Bezeichnung einer Münzeinheit der Volksrepublik Laos 1976 übernommen, allerdings erst seit 1980 (nach der Währungsreform im Dezember 1979) in Werten von 10, 20 und 50 Att aus Aluminium ausgeprägt: 100 Att = 1 Kip.
Attischer Münzfuß
Der bedeutendste Münzfuß der griechischen Antike, nach dem Landstrich Attika um Athen benannt. Er wurde er bereits im Athen Solons (594-560 v. Chr.) aus dem euböischen Münzfuß übernommen, deshalb auch manchmal attisch-euböischer Münzfuß genannt. Dieser Münzfuß basierte auf der Mine von etwa 436,6 g, die in 100 Drachmen zu je 4,37 g und in 600 Obole zu je 0,73 g unterteilt ist. Durch die Vormachtstellung im Attischen Seebund setzte die Seemacht Athen den Münzfuß in der Ägäis und de...
Auferstehungstaler
Die ersten Taler der Stadt Braunschweig von 1545/46 mit der Auferstehung Christi auf der Vorderseite und dem Braunschweiger Löwen auf der Rückseite der Münze.
Aufwertung
Das Gegenteil von Abwertung, nämlich die Erhöhung des Wertes einer Münze oder einer Währungseinheit. Im modernen Sinn in Bezug auf den Goldwert, den Wert in anderer Währung oder einer sonstigen Rechnungseinheit gebraucht, im geschichtlichen Sinn die Erhöhung des Edelmetallanteils in einer Einheit des gebräuchlichen Rechengeldes. Letzteres geschah häufig nach einem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Währung. Dann war der Münzherr gezwungen, durch Erhöhung des Fein- bzw.Raugehalt...
Augsburger Reichsmünzordnungen
Die Esslinger Reichsmünzordnung von 1524 hatte sich nicht durchgesetzt: Der Reichsguldiner wurde nur in wenigen Versuchen geprägt, die anderen Münzsorten wurden nur wenig geprägt, außerdem hatte sich die allmähliche Verschlechterung der kleineren Münzsorten fortgesetzt. Aufgrund der Reformationswirren dauerte es 27 Jahre, bis auf dem Augsburger Reichstag 1551 eine längst fällige neue Münzordnung für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation verabschiedet werden konnte.
Die neue Mü...
August d'or
Sächsische goldene 5-Taler-Stücke (Pistolen), nach dem Kurfürsten von Sachsen Friedrich August II. (1733-1763) benannt. Sie wurden 1752-1754 und 1777-1845 mit einem Feingewicht von 6,03 g geprägt und waren hoch angesehen. Dies änderte sich allerdings nach der Besetzung Sachsens durch Preußenunter Friedrich II. (dem Großen), während des Siebenjährigen Kriegs (1756-1763). Im Rahmen der Münzverschlechterungen zur Finanzierung des Kriegs ließ Friedrich der Große mit den erbeuteten Origin...
Augustalis
Mittelalterliche Goldmünze unter Kaiser Friedrich II. (1194-1250), als König von Sizilien ab 1231 in Brindisi und Messina geschlagen. Die Augustalen zeigen auf ihrer Münzvorderseite den Kaiser als lorbeerbekränzten Imperator in antikem Gewand, in deutlicher Anlehnung an die Goldmünze der römischen Kaiser (Aureus), auf ihrer Rückseite einen naturalistischen Adler. Das Raugewicht betrug 5,26 g (855/1000) und passte damit in die nordafrikanischen und byzantinischen Münzsysteme. Daraus erkl
Augustus
Beiname des ersten römischen Kaisers (63 v. Chr.-14 n. Chr.) wörtlich der Erhabene. Der Großneffe Caesars, der eigentlich Octavian hieß, nahm den Namen 27 v. Chr. an. Alle römischen Kaiser nach ihm nahmen den Ehrennamen Augustus an, der meist als Zusatz am Ende des Namens getragen wurde. Die Person des Augustus ist heilig, unverletzlich und Träger der göttlichen Würde. Der Beiname ist auf Legenden römischer Münzen mit AVG abgekürzt, vom 3.- 5. Jh. n. Chr. gibt es auch AVGG und AVGGG f...
Auktionen
Versteigerung, vor allem wertvoller Münzen. Jährlich finden in Deutschland ca. 60 Münzversteigerungen statt. Zu deren Vorbereitung werden bebilderte Auktionskataloge versandt, die neben den Schätzpreisen auch die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Auktionshauses beinhalten. In der Regel sollte die Möglichkeit schriftlicher und mündlicher Gebote gegeben sein, die üblicherweise nach dreimaligem Ausruf des Höchstgebotes zum Zuschlag führen. Der Zuschlag bringt eine Kaufverpflichtung mit ...
Aureole
Vom lat. aureolus (dt.: golden, Goldstück) bezeichnet den die ganze Figur umhüllenden runden Heiligenschein, der in der christlichen Kunst meist Christus oder Maria umhüllt. Auf Münzen wurde aber meist die spitzovale Form, die Mandorla, oder der den Kopf umhüllende Nimbus verwendet.
Aureoltyp
Bezeichnung antiker Gepräge, die 1867 im südfranzösischen Aureol (bei Marseille) gefunden wurden. Der älteste Schatzfund im gallischen Raum umfasst etwa 2000 Kleinsilbermünzen aus dem späten 6./frühen 5. Jh. Er setzt sich zusammen aus Münzen griechischer Kolonien aus dem kleinasiatischen und unteritalischen Raum sowie aus vielen Nachschlägen, die vermutlich in der Umgebung von Massilia (Marseille), der nördlichsten griechischen Stadtgründung der Antike, geschlagen wurden. Auf den Vs.n...
Aureus
Der Aureus war die Goldeinheitsmünze des Römischen Reichs. Die Goldmünze stammt noch aus der Zeit der Römischen Republik und wurde bis zur konstantinischen Zeit (zu Beginn des 4. Jh.s n. Chr.) geprägt. Schon vor Caesars Sieg über die Gallier wurden z.B. von Sulla (82-79 v. Chr), Pompeius (71 v. Chr.) u.a. schon Aurei gemünzt, aber nur selten und sporadisch. Der aus den Kriegszügen Caesars erbeutete Goldschatz ermöglichte eine erste reichhaltigere Prägung des Aureus, der 1/40 röm. Pfun...
Aurichalkum
Antike Bezeichnung für messingähnliches Metall, das für wertvoller als reines Kupfer galt. Der Name leitet sich vom altgriechischen „oreichalkos“ (Bergerz) ab und bedeutet Golderz, wegen der goldähnlichen Farbe der Legierung. Seit der Münzreform des Augustus wurden der Sesterz (27,3 g) und sein Halbstück, der Dupondius aus dieser Kupfer-Zink-Legierung im Verhältnis von ca. 4:1 hergestellt. Unter Philippus sank der Zinkanteil auf bis zu 5%.
Ausbeutemünzen, -taler
Bergwerksmünzen
Münzen, die aus dem Erz bestimmter Bergwerke oder Regionen stammen und auf deren Herkunft meist auf der Münze direkt hingewiesen wird. Solche Hinweise sind in In- und Umschriften der Münzen ebenso zu finden wie in Bildmotiven der betreffenden Gruben oder Regionen. So gibt es Ausbeute-Dukaten, -Löser, -Taler, -Gulden und -Groschen. Aber auch aus Flusssand gewonnene Goldstücke zählen zu den Ausbeutedukaten. Sie zeigen oft Personifikationen und Landschaftsdarstellungen der Fl...
Ausbringung
Aufzahl
Die Anzahl einer Münzsorte, die aus einem bestimmten Münzgrundgewicht, z.B. der feinen Kölnischen Mark, geprägt werden musste, auch Aufzahl genannt. So war die Aufzahl der Reichstaler 9 auf eine feine Mark, weil aus dem Gewicht einer Kölnischen Mark von 233,81 g die Anzahl von 9 Reichstalern geprägt wurden. Mit der Einführung des metrischen Systems wurde im 19. Jh. das Zollpfund (500 g) zur Grundlage der Ausbringung.
Ausgleichsmünzen
Münzen, die Differenzen im Zahlungsverkehr zwischen zwei Währungssystemen oder zwei unterschiedlichen Münzfüßen ausgleichen. Viele antike Münzen hatten diese Vermittlungsfunktion. Im 17./18. Jh. wurde der Bankotaler eher zufällig zu einer Ausgleichsmünze, die zwischen dem niederländischen Albertustaler und dem Reichstaler vermittelte.
Ausschussmünzen
1. Münztechnischer Ausdruck für Münzen, die aufgrund von Fehlern die vorgeschriebene Qualität nicht erreichen und deshalb nicht in den Umlauf gelangen. Solche Mängel können z.B. durch Fehlprägung oder Gewichtsverlust auftreten. Bei Prüfungen und Kontrollen werden diese mangelhaften Prägungen ausgeschieden und von den Münzstätten wieder eingeschmolzen.
2. Bezeichnung für Münzen, die für den Sammler wertlos sind: Die Wertlosigkeit kann durch zu große Erhaltungsmängel bedingt sein.
Austral
Argentinische Währungseinheit von 1985 bis 1991. 1 Austral = 100 Centavos. Bei der Währungsreform vom 1.1.1992 wurde die Peso-Währung wieder eingeführt. Für 10.000 Austral wurde 1 argentinischer Peso getauscht.
Auswurfmünzen
Kleinmünzen, die bei festlichen Anlässen, z.B. Krönungsfeierlichkeiten, Fürstenhochzeiten etc. unter das Volk geworfen wurden. Meist wurden diese Münzen speziell hergestellt und mit einem dem jeweiligen Ereignis angemessenen Münzbild beprägt. Diese Tradition kann bis in die römische Kaiserzeit zurückverfolgt werden, damals verwendete man auch Kursmünzen.
Auto-Dollar
Sammlerbezeichnung für die chinesische Dollarmünze aus dem Jahr 1928 zur Eröffnung der ersten befestigten Straße in der Provinz Kweichow (Republik China). Das Münzbild zeigt einen PKW im Perlkreis.
Automatenmarken
Münzähnliche Marken, die von Behörden oder der Automatenindustrie speziell zum Gebrauch für Automaten entwickelt wurden, besonders in Zeiten fehlenden Hartgelds. Mittlerweile sind die neuen Kursmünzen im Begriff zu Automatenmünzen zu werden, da der Automatentauglichkeit eine größere Bedeutung zukommt als der Gestaltung. Ein Beispiel hierfür ist das unattraktiv gestaltete 5-DM-Stück.
Autonome Münzen
Bezeichnung von Münzen autonomer Städte und Staaten aus dem griechisch-hellenistischen Raum aus der Zeit vor der Unterwerfung durch die Römer. Alle griechisch beschrifteten Gepräge der Antike werden nach geographischen Gesichtspunkten den griechischen Münzen zugeordnet. Zur Unterscheidung von Provinzial- oder Kolonialmünzen versuchte man autonom geprägte griechische Münzen mit dem Begriff autonome Münzen oder Autonomiemünzen zu bezeichnen. Siehe auch quasiautonome Münzen.
Autorgroschen
Groschenmünze der Stadt Braunschweig aus dem Jahr 1499. Der Name erklärt sich aus dem Münzbild, das den Schutzpatron der Stadt, den heiligen Autor, abbildet. Der „große Autorgroschen“ wurde mit 12, das Halbstück mit 6 braunschweigischen Pfennigen bewertet.
Avers
Vorderseite einer Münze
Die Vorderseite einer Münze, auch als Avers (abgekürzt Vs. oder Av.) bekannt, ist die Hauptseite des Geldstücks. Sie trägt in der Regel das Bild des Münzherrn oder Herrschers, dessen Wappen oder Monogramm. Alternativ kann auch ein anderes Symbol oder Merkmal auf dem Avers einer Münze abgebildet sein, das die Münzhoheit der Stadt, des Staats oder des Münzherrn repräsentiert.
Bei antiken Münzen wird die durch den Unterstempel geprägte Seite als Vorderseite bezei...
Ayam
Aus Zinn gegossene Kleinplastiken in Form eines Hahns, die als Geld im 18./19. Jh. auf der malayischen Halbinsel und (als kupferner Duit Ayam) auf der Insel Sumatra umliefen. Die Benennung kommt aus dem Malaiischen und bedeutet Hahn. Siehe auch Buaya.