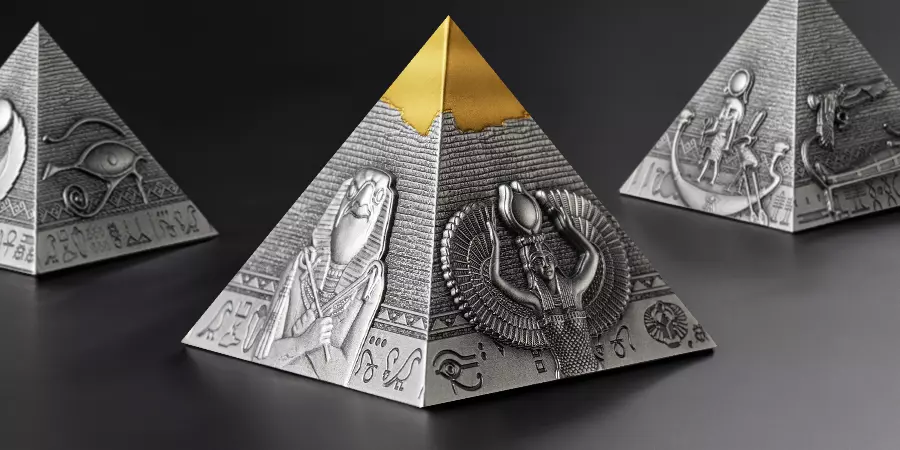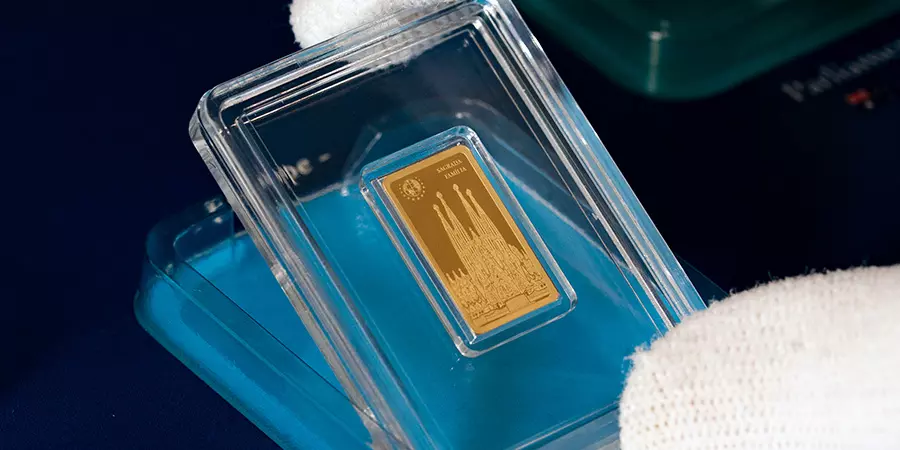Das große Reppa Münzen-Lexikon
F
160 Beiträge in dieser Lexikon KategorieF (Münzstättenzeichen)
Münzbuchstabe der Münzstätten Stuttgart (auf Münzen des Deutschen Reichs ab 1873 bis hin zur Bundesrepublik Deutschland), Magdeburg (auf preußischen Münzen 1751-1767), Hall/Tirol (auf Münzen des Römisch-Deutschen Reichs 1766-1805), Angers (auf französischen Münzen 1540-1661).
Fä
Auch Fai, Rai oder Fei nennen die Yap-Insulaner auf den westlichen Karolinen ihr kurioses Steingeld.
Fahrbüchse
Mehrfach verschlossene Büchse aus Eisen, die zur Aufbewahrung von Zainproben und Musterprägungen diente. Nach den Reichsmünzordnungen wurden zur Kontrolle der Münzstätten in Deutschland zweimal im Jahr sog. Kreisprobationstage abgehalten. Dazu wurden in die mit einem Schlitz versehenen Fahrbüchsen eingewickelte Proben eingeworfen, die nach den Augsburger Reichsmünzordnungen mit Angaben zu Datum, Gewicht und Feingehalt der Legierung versehen sein mussten. Diese Angaben wurden auf den Kreis...
Falkendukat
Jagdmünzen (Dukaten) aus der Regierungszeit des Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (1729-1757), die auf der Vs. eine Szene der Reiherbeizjagd mit zwei Falken und dem Falkner zu Pferd, auf der Rs. einen Beizfalken zeigen.
Falkentaler
Sammlerbezeichnung für zwei talergroße Medaillen, die der Ansbacher Medailleur Johann Samuel Gözinger fertigte. Beide Vs.n zeigen das Brustbild des Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (1729-1757), auf der Rs. ist ein sitzender Falke mit Haube bzw. eine Jagdszene der Reiherbeize zu sehen.
Falschmünzerei
Illegale und strafbare Nachahmung von gesetzlich geltenden Zahlungsmitteln, im Gegensatz zur Herstellung von historischen Münzen zum Nachteil des Sammlers (siehe Münzfälschung). Die Falschmünzerei ist so alt wie das Geld und wurde schon in Gesetzen des athenischen Gesetzgebers Solon (594-560 v. Chr.) und von den römischen Kaisern unter drastische Strafen gestellt. In der Antike wurde die Falschmünzerei hauptsächlich in Form von Nachgüssen unter Gewichtsverminderung und Verwendung unedler...
Falsifikate
Falsche Münzen
Bezeichnung für falsche Münzen der Falschmünzerei und der Münzfälschung sowie für nachgeahmtes und verfälschtes Papiergeld. Der Ausdruck setzt sich aus dem lat. falsus (falsch) und factum (gemacht, geschaffen) zusammen.
Faluce
Kupfermünze der europäischen Kolonialmächte Niederlande und Großbritannien auf Ceylon (heute Sri Lanka). 4 Faluce = 1 Fanam
Falus
Beim Falus handelt es sich um eine alte Münzwährung aus Kupfer, die sich unter anderem im ehemaligen Emirat Buchara im heutigen Usbekistan in Umlauf befand. Die Münze ist eng mit der wechselvollen Geschichte des Landes verbunden, und wurde erst mit der Auflösung des Emirates und dem Anschluss an die UdSSR im Jahr 1920 als offizielle Währung abgeschafft.
Der Falus ist dabei die Untereinheit des Tenga (oder Tenge): 10 Falus galten einen bucharischen Tenga. Ersetzt wurde die ursprüngliche Wä...
Famataler
Breite Talermünze, geprägt anlässlich des Todes des Kurfürsten Johann Georg II. (1656-1680) von Sachsen. Sie gehört damit zum Gebiet der Sterbemünzen. Sie wurde nach der Darstellung der geflügelten Fama (Personifizierung des Ruhms) benannt, die sich auf Vs. der Münze über dem sächsischen Wappen erhebt, das in das Band des Hosenbandordens eingefasst ist. Daher auch die Umschrift HONI SOIT QUI MAL Y PENSE, die Inschrift des Ordens, dem der sächsische Kurfürst als Ritter angehörte.
Familientaler
Sammelbezeichnung für Talermünzen, die auf den Münzbildern die Mitglieder einer regierenden Familie zeigen. Beispiele sind die Dreibrüdertaler, die Achtbrüdertaler aus Sachsen-Weimar (1607-1619) sowie die unter Friedrich I. (1675-1691) von Sachsen-Gotha-Altenburg geprägten Stücke, die ihn mit seinen sechs Brüder zeigen u.a.
Fanam
Alte indische Münzeinheit, die vermutlich schon seit dem 9. Jh. als Goldfanam in den südindischen Tamilstaaten, Travancore und an der Malabarküste vorkommt, gesichert ist ihre Verbreitung im 14. Jh. auf Ceylon (heute Sri Lanka). Der Fanam war sowohl die kleinste Gold- als auch die größte Silbereinheit. Der Ausdruck geht wohl auf das Hindi-Wort „Panam“ zurück, was – ähnlich wie das griech. „Drachmon“ – soviel wie „eine Handvoll“ bedeutet, nämlich 80 Rati-Samenkörner, die ...
Fano
Bezeichnung des kleinen silbernen Fanam aus dem indischen Tranquebar (Dänisch-Ostindien), der zwischen 1730 und 1818 geprägt wurde, zwischen 1755 und 1808 allerdings unter dem Namen Royalin. 1 Fano galt 80 Kas (Cash), 8 Fanos wurden mit 1 Rupie, 18 Fanos mit 1 Speciesdaler bewertet.
Fanon
Bezeichnung des Fanam aus Pondichery (Französisch-Indien). Die silbernen Fanons von Pontdichery zeigen auf den Vs. meist eine Krone, auf der Rs. meist französische Lilienblüten (fleur de lis), manche sind auch in indischem Stil gehalten. Der Fanon von Pondichery galt aber 1/5 (nicht 1/8) Rupie. Es gab auch Halbstücke oder Royalins und doppelte Fanons.
FAO-Münzen
Prägungen, die seit 1968 nach einem Plan der FAO (Food and Agriculture Organization), der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen, in einer ganzen Reihe ihrer Mitgliedsstaaten hergestellt wurden. Ihre Hauptziele sind die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und des Fischfangs zur Bekämpfung des Hungers und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den armen Ländern. Die FAO verspricht sich von der Ausgabe der Münzen Gewinne, die sie für ihre Ziele in...
Farthing
Kleine englische Silber-, später Kupfermünze, die zuerst unter König Eduard (Edward) I. (1272-1307) mit einem Gewicht von 0,3-0,4 g ausgegeben wurde. Ihre Benennung leitet sich von fourthling (Viertelstück) nach ihrem Wert als Viertelpenny ab. Obwohl der Bedarf nach den Penny-Teilstücken groß war, wurden sie nur unregelmäßig ausgegeben. Seit 1612 gab es kupferne Farthings (Harrington Tokens), ab 1672 kam es zu regelmäßigen staatlichen Ausgaben der Kupferstücke bis zum Ende des Jh.s. U...
Fasces
Umschnürtes Rutenbündel mit herausstehendem Beil, in der Antike Symbol der Herrscher- und Amtsgewalt. In der Römischen Republik wurde es von den Liktoren getragen und findet sich deshalb auch auf Bronzemünzen der Republikzeit dargestellt. Die Fasces-Typen erscheinen in der Neuzeit beispielsweise als Symbol für die republikanische Verfassung auf französischen Münzen der Revolutionszeit oder auf italienischen Münzen der faschistischen Ära.
Denar der Röm. Republik...
Fassungsspuren
Beschädigungen, entstanden durch die Bearbeitung von Münzen, die als Amulette oder als Schmuck getragen wurden. Sowohl beim Einfassen der Münze, als auch beim Ausfassen entstehen neben geringfügigen Klammerspuren auch Löt- und Schweißspuren (Henkelspur), die sich je nach Grad der Beschädigung sehr wertmindernd auswirken können.
Fatimiden
Ismailitisch-schiitische Dynastie, die im 10./11. Jh. in Nordafrika, teilweise auch in Syrien und Palästina, von 969 bis 1171 n. Chr. in Ägypten herrschte. Ägypten erlebte unter der Herrschaft der Fatimiden eine Blütezeit. Die Bezeichnung leitet sich von dem Namen der als Ahnfrau geltenden Fatima ab, einer Tochter Mohammeds und Gattin Alis, des Anführers der Schiiten.
FDC
Abkürzung für den Erhaltungsgrad „Stempelglanz“ in den Niederlanden und den romanisch sprachigen Ländern Frankreich (Fleur de coin), Italien (fior de conio), und Spanien (flor di cuño).
fecit
Abgekürzt „f.“ oder „fec.“ stammt aus dem Lateinischen (dt.: machte) und bezeichnet – zusammen mit dem Signum (Signatur) des Künstlers – den Stempelschneider der betreffenden Münzen oder Medaillen. Zur Bezeichnung des Auftraggebers wurde aber mit den Ausdrücken fieri fecit oder direxit (dir.) abgezeichnet, mit dem Hinweis invenit (inv.) zeichnete der Gestalter (Designer) der betreffenden Medaille oder Münze.
Fecunditas
Römische Göttin der weiblichen Fruchtbarkeit, meist auf Münzen römischer Kaiserinnen mit kleinen Kindern und den Attributen Füllhorn, Caduceus oder Zweig dargestellt.
Darstellung der Fecunditas auf einem Denar der Julia Mamaea
Federgeld
Zahlungsmittel und Wertobjekt auf den Santa-Cruz-Inseln im Osten Melanesiens aus den wertvollen roten Vogelfedern des Kardinalhonigfressers. Die Federgeldrollen wurden ursprünglich auf der Insel Ndeni, später auch auf anderen Inseln des Archipels arbeitsteilig von Spezialisten hergestellt. Die von „Geistern erhaltenen“ Fähigkeiten der „Geldmacher-Clans“ wurden erblich weitervermittelt. Der „Vogelfänger“ fing die spatzengroßen Vögel mit Hilfe von Fallen, riss ihnen die roten Kop...
Federtaler
West- und südwestdeutsche Bezeichnung für die seit 1741 in Straßburg geprägten Laubtaler (Ecu blanc), nach ihrem auf dem Münzbild dargestellten Lorbeerkranz aus Laub, der wie Federn aussah.
Fedi di credito
Auch Fedi di deposito, waren seit der Mitte des 16. Jh.s Einzahlungsquittungen der öffentlichen Banken, zunächst in den Städten des Königreichs beider Sizilien, im 17. Jh. auch in anderen italienischen Städten. Sie waren durch Indossament übertragbar und konnten auf Konten gutgeschrieben oder in klingender Münze ausgezahlt werden. Der Fede di credito konnte oftmals den Besitzer wechseln, bevor er eingelöst wurde, und ist somit der Vorläufer der Banknoten.
Fehlprägungen
Als fehlerhafte Münzen werden Münzen beschrieben, die – bedingt durch falsches Verhalten beim Prägevorgang oder in Verbindung mit Mängeln am Material oder Stempel – dem gängigen Qualitätsstandard abweichen. Durch Verwechslungen (unpassende Stempelpaare, falscher Schrötling), Verdrehungen, Risse oder Sprünge der Stempel entstandene Fehlprägungen müssen sich für den Sammler nicht immer wertmindernd auswirken. Vor allem einzigartige Exemplare oder kleine Auflagen können im Preis ste...
Fehrbelliner Siegestaler
Ereignismünzen in Talerform, die der „Große Kurfürst“ von Brandenburg-Preußen Friedrich Wilhelm I. (1640-1688) auf die siegreiche Schlacht bei Fehrbellin am 28. 6. 1675 gegen die Armee der damaligen schwedischen Großmacht prägen ließ. Die Talermünzen zeigen auf der Vs. den Kurfürsten mit gezücktem Schwert auf einem Pferd galoppierend. Die Rückseiten sind beschriftet oder mit der Siegesgöttin (Victoria) bzw. der Friedensgöttin (Pax) versehen.
Feilspuren
Solche Spuren an Münzen können aus verschiedenen Gründen entstanden sein, z.B. bei der Entnahme von Metallproben oder bei der Beseitigung von Lötstellen, durch die Umarbeitung zu Amuletten oder Schmuck entstanden sind (Fassungsspuren). Auch das Justieren al pezzo mit der groben Justierfeile führte zu Feilspuren (Justierspuren). Das Befeilen der Münzen zu betrügerischen Zwecken (bis ins 18. Jh.) fiel in den Zeiten der Justierung al marco weniger auf.
Feinbuch
Im 19. Jh. im Edelmetallhandel gebräuchliches Buch mit Tabellen zur Errechnung des Verhältnisses von Rau- und Feingewicht bzw. zur Umrechnung des Feingehalts (Karat, Lot, Grän) in Gewicht (Gramm).
Feingehalt
Auch Feine, Feinheit oder Korn bezeichnet den chemisch reinen Anteil eines Edelmetalls in einer Legierung, der seit der Einführung des metrischen Systems in Promille (Tausendteilen) angegeben wird. Bis in die Mitte des 16. Jh.s waren Marken das Basisgewicht für die Einteilung des Mischungsverhältnisses von Silbermünzen. Die bekannteste und gebräuchlichste in Deutschland war die Kölner Mark im Gewicht von 233,865 g. Die Mark zerfiel in Deutschland und den Niederlanden in 16 Lot, 64 Quentche...
Feingewicht
Der Gewichtsanteil an Gold (bei Goldmünzen) oder Silber (bei Silbermünzen), der in der entsprechenden Münze enthalten ist, also das Nettogewicht in g. Im Gegensatz dazu steht das Raugewicht, in dem das Brutto- oder Gesamtgewicht einer Münze oder eines Barrens angegeben wird. Zur Zeit der Metallwährung bestimmte das Feingewicht den Wert der Münze.
Feinsilbermünze
Münze aus feinem Silber, die aufgrund des Silberreichtums im Harz in größeren Mengen vor allem in der Grafschaft Stolberg und in Braunschweig-Lüneburg geprägt wurde. Von der Mitte des 17. bis in das erste Viertel des 19. Jh.s ließen die Münzberechtigten Stücke im Wert von einem Zweidritteltaler (24 Mariengroschen), einem Dritteltaler (12 Mariengroschen) und einem Sechsteltaler (6 Mariengroschen) mit Aufschriften wie FEIN SILBER für den inländischen Umlauf prägen. Wegen ihres hohen Sil...
Feld
Bezeichnung für die meist glatte Grundfläche der Münze (Münzfeld), von der sich die Beschriftung und die Bilder abheben. Bei den Prägungen mit den Erhaltungsgraden „polierte Platte (PP)“ und „proof-like (PL)“ ist die Unversehrtheit der spiegelnden Felder ein wichtiges Merkmal.
Feldklippen
Belagerungs- und Notmünzen in Klippenform, die von Belagerten, manchmal auch von den Belagerern der Städte oder Festungen als Zahlungsmittel ausgegeben wurden. Bekannt sind die Landauer und Schweinfurter Feldklippen. Siehe auch Belagerungsmünzen.
Landauer Feld-Klippe zu 2 Gulden 8 Kreuzer 1713
Feldzeichen
Fahnen und Standarten, die die Truppen voneinander unterschieden, vor allem in der Römerzeit häufig auf Münzbildern zu finden. Siehe auch Labarum, Legionsadler, Signum und Vexillum.
Felicitas
Römische Personifikation des Glücks und des Segens. Auf Münzen der röm. Kaiserzeit als weibliche Person stehend und sitzend dargestellt, meist mit den Attributen Füllhorn und Merkurstab.
Darstellung der Felicitas auf einem Dupondius des Vespasian
Fels
Fulus, Fals
Auch Fals, Falus, Fols oder Fulus ist eine Kupfermünze, die seit dem 7. Jh. v. Chr. im gesamten arabischen Raum verbreitet war. Der Ausdruck leitet sich von dem byzantinischen Follis ab. Der arabische Fels wurde zunächst auch nach byzantinischem Vorbild geprägt. Ursprünglich galten 48 Fulus = 1 Dirhem. Zur Zeit des Kalifats der Abbasiden wurde neben der üblichen religiösen Legende auch der Name des Münzherrn, der Ort und das Prägejahr auf der Münze genannt. Im 11. Jh. verlor...
Fen
Chinesische Gewichtseinheit vor Einführung des Dezimalsystems. Nach der Konvention von 1858 sind 100 Fen = 10 Ch'ien = 1 Tael. Nach der Währungsreform 1953 wurde der Fen in der Volksrepublik China als 1-, 2- und 5-Fen-Stück in Aluminium ausgeprägt, zum ersten Mal 1955. 100 Fen = 10 Chiao = 1 Yuan.
Fenice
Beiname der sizilianischen Oncia, die 1734-1759 in der Regierungszeit des bourbonischen Königs Karl (Carlo di Borbone) geschlagen wurde. Der Name leitet sich von dem Münzbild auf der Rs. ab, das den Vogel Phönix (ital.: fenice) zeigt. Die Vs. trägt die Büste des Herrschers.
Fenig
Polnische Bezeichnung für Pfennig (Pluralform: Fenigow). Während des 1. Weltkriegs wurden im Deutschen Reich 1-, 5-, 10- und 20-Fenig-Stücke aus Eisen und Zink für das geplante Königreich Polen geprägt.
Feorling
Bezeichnung des Farthing in Irland, der in der Irischen Republik aus Bronze mit dem Bild der Waldschnepfe auf der Rs. bis zur Einführung des Dezimalsystems 1971 geprägt wurde. 4 Feorling = 1 Pingin (Penny).
Ferding
Baltische Silbermünze im Wert einer Viertelmark aus dem 16. Jh., wahrscheinlich schon seit 1516 in Livland in Umlauf. Nach der Eroberung Estlands 1561 führte der schwedische König Erik XIV. (1560-1568) ein neues Münzsystem in Estland ein, u.a. den silbernen Ferding (Vierling). Die Stücke trugen das Wappen des Reichs und den Schild der Stadt Reval im Münzbild. Auch in Ösel und Dorpat wurden Ferdinge beigeschlagen.
Ferraritäten
Der Ausdruck ist eine Wortschöpfung aus Raritäten und Ferrari und bezeichnet Sonderprägungen für den Münzsammler Ferrari, die in den staatlichen Münzstellen des Deutschen Reichs speziell hergestellt wurden. Dabei handelt es sich beispielsweise um originale Markstücke, die aber mit diesem Jahrgang offiziell nicht geprägt wurden oder Stücke mit fehlendem Perlkreis usw. Die Sammlung wurde 1927 bei Schulmann, Amsterdam, versteigert.
Fert
Beiname einer Reihe von Goldmünzen aus Savoyen, auf denen die Buchstaben FERT zu sehen sind und die zwischen 1450 und 1550 geschlagen wurden. Die Bedeutung der Abkürzung ist nicht ganz geklärt. Eine Erklärung ist die, dass es sich um die Anfangsbuchstaben des Mottos FORTITUDO EIUS RHODUM TENUIT (Seine Tapferkeit hielt Rhodos) handelt, das die Herzöge von Savoyen in Anspielung auf die angebliche Verteidigung der Insel durch Amadeus IV. (1232-1253) angenommen hatten. Auf späteren Goldstücke...
Fettmännchen
Ursprünglich wohl volkstümliche Bezeichnung für eine niederrheinische Silber-, später Billonmünze im Wert von einem halben Stüber oder 8 bzw. 10 Hellern. Die Herleitung des Namens ist nicht vollständig geklärt: Der Ausdruck könnte sich als Gegensatz zu den niederländischen Magermännchen gebildet haben, die nur die Hälfte der Fettmännchen galten. Ein andere Erklärung geht von dem schmierigen Aussehen der dünnen Stücke aus, das durch den häufigen Gebrauch verursacht wurde. In den ...
Feudalmünzen
Im weiteren Sinn bezeichnet der Begriff (von lat. feudum = Lehen) die Münzen, die von den Lehnsherren der mittelalterlichen Feudalstaaten geprägt wurden. Besonders ausgeprägt war der Feudalismus in Frankreich, dort entwickelte sich die ausgeprägteste feudale Staatsordnung auf dem europäischen Kontinent. Die von der französischen Krone mehr oder weniger unabhängige Münzprägung aus dem Mittelalter (und später) wird im engeren Sinn als Feudalprägung bezeichnet. Die Schwächung der Zentra...
Feuerspur
Gebräuchliche Bezeichnung für Brandspuren auf Münzen, die nach einem Brand auf Münzen entstehen. Der Ausdruck wird auch in Auktionskatalogen verwendet.
Feuervergoldung
Technik zur Vergoldung von Münzen, Medaillen oder anderen Metallgegenständen, die aus der späten römischen Kaiserzeit stammt. Dabei wurden die Oberflächen der zu vergoldenden Stücke mit einer Quickbeize (meist eine Lösung aus Quecksilbernitrat) gewaschen und mit einem Amalgam aus Quecksilber und Feingold versehen. Durch Erhitzen verdampfte das Quecksilber, sodass ein fester Überzug aus Feingold übrig blieb. Schon ab dem 3./4. Jh. v. Chr. wurde dieses Verfahren als Methode der Falschmün...
Fiala, Eduard
Tschechischer Numismatiker, Ehrendoktor der Universität Prag, Präsident des Vereins für Numismatik, der 1919 in Prag gegründet wurde sowie Herausgeber der numismatischen Zeitschrift Vestnik (Prag 1919-1923). Die Schwerpunkte seiner numismatischen Forschungsarbeit lagen auf den Gebieten der habsburgischen, welfischen, böhmischen und tschechischen Münzen und Medaillen. Sein 9-bändiges Hauptwerk „Münzen und Medaillen der Welfischen Lande“ (Prag 1904-1919) basiert auf den Sammlungen des ...
Fiatgeld
Was ist Fiatgeld?
Fiatgeld ist eine Form von Währung, deren Wert nicht durch physische Rohstoffe wie Gold oder Silber gedeckt wird, sondern durch das Vertrauen in die ausgebende Regierung und deren wirtschaftliche Stabilität. Das Wort „Fiat“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Es werde“ oder „Es sei“, was die Tatsache unterstreicht, dass der Wert des Geldes durch staatliche Anordnung festgelegt wird. In modernen Volkswirtschaften ist Fiatgeld die gängigste Form von Währung....
FIDEM
Federation International de la Medaille
Abkürzung für Fédération Internationale de la Médaille, eine internationale Gesellschaft mit Sitz in Paris, die sich seit ihrer Gründung 1937 der Förderung der Medaille und der Medailleure verschrieben hat. Die Gesellschaft veranstaltet u.a. regelmäßige Ausstellungen und Versammlungen in verschiedenen Ländern und gibt in Paris die Zeitschrift „Médaille“ heraus.
Fides
Römische Personifikation der Treue, des Eids und des Einhaltens eines Versprechens. Sie ist als weibliche Figur auf römischen Bronzen der Republik- und Kaiserzeit dargestellt, zivil mit den Attributen Ähren und Fruchtkorb oder militärisch mit Legionszeichen. Auch in den außenpolitischen Vorstellungen Roms spielte die Fides eine große Rolle. Sie stand als Symbol für die Einhaltung von getroffenen Absprachen. Auf Bronzemünzen der Kaiserzeit finden sich Typen ohne personifizierte Darstellun...
fieri fecit
Bezeichnung für den Auftraggeber auf Medaillen seit der Renaissance. Der Ausdruck kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „hat anfertigen lassen“.
Filiberto
1. Goldmünze zu 9 Lira, die zur Regierungszeit von Emanuel Philibert (Emanuele Filiberto, 1553-1580) auch als dreifache Stücke im Herzogtum Savoyen geschlagen wurde. Die Einfachstücke zeigen auf den Vs.n das Brustbild des Herzogs, auf den Rs.n einen Elefanten in einer Schafherde mit den lateinischen Worten INFESTUS INFESTIS (schwach durch Schwächlinge). Die Dreifachstücke zeigen die Brustbilder des Herrscherpaars, auf der Rs. eine Schlange.2. Silbermünze im Wert ein...
Filippo
Felippo
Auch Felippo, ist eine Talermünze von Mailand, die in der Regierungszeit des spanischen Herrschers Philipp (Filippo) II. (1556-1598) eingeführt wurde. Im Vergleich zu seinem schwereren Vorgänger, dem Ducatone Karls (Carlo) V., wog er lediglich 27,5 g (26 g fein), wurde aber ebenso mit 100 Soldi bewertet. Nach dem Greshamschen Gesetz, wonach das schlechtere Geld das bessere verdrängt, löste der Filippo allmählich den Ducatone ab. Um die Jahrhundertwende stieg der in großen Mengen g...
Filler
Ungarisch für Heller, kleine Währungsmünze Ungarns seit 1892. 100 Fillér = 1 Korona. Sie wurde in einfachen und doppelten Stücken aus Bronze, die 10 Fillér-Stücke wurden aus Neusilber oder Nickel und die 20-Fillér-Stücke aus Nickel ausgebracht. Während und nach dem 1. Weltkrieg wurden zwischen 1916 und 1921 auch Mehrfachstücke des Fillér in ungehärtetem Eisen ausgebracht. Die Münzbilder zeigen auf der Vs. die Stephanskrone und die Jahresangabe, auf der Rs. die Wertangabe. Seit 1925...
Fils
Kleinste Münzeinheit in folgenden arabischen Staaten: Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate (in diesen Ländern entsprechen 1000 Fils = 1 Dinar) und Jemen (100 Fils = 1 Rial).
Finkenaugen
Kleine mittelalterliche Denare in Mecklenburg und Pommern, siehe unter Vinkenaugen.
Finnische Mark
Bei der Finnischen Mark handelt es sich um die ehemalige Währung Finnlands, die vor der Einführung des Euro in dem nordeuropäischen Land im täglichen Zahlungsverkehr genutzt wurde. Weitere Bezeichnung für die Finnische Mark lauten markka (finnisch), mark (schwedisch) oder auch Finnmark (deutsch). Gebräuchliche Abkürzungen waren mk, Fmk oder FIM (nach ISO 4217). Eine Mark wurde in 100 Pfennige unterteilt. Diese wurden auf Finnisch als penni (Plural: penniä) bezeichnet.
Eckdaten der Finnis...
Fiorino
1. Italienische Bezeichnung der Goldmünze aus Florenz, nach dem Bild des Stadtwappens, einer Blüte (fiore), benannt. Siehe unter Floren.2. Bezeichnung für eine Groschenmünze aus Florenz aus dem 13. Jh., die dem goldenenFloren vorausging, im 14. Jh. Popolino genannt. Die Silbermünze zeigt eine Lilienblüte (Stadtwappen), wie die Mehrzahl der Florentiner Münzen aus dieser Zeit. 3. Piemonteser Silbermünze, die in der Regierungszeit des Herzogs Emanuel Ph...
Fiorino della regina
Beiname des goldenen Franc à pied, den die Königin (lat.: regina) Johanna von Neapel (Jeanne de Naples) für die Provence schlagen ließ.
Fiorino di camera
Bezeichnung der Goldmünze des Kirchenstaats, die zum ersten Mal unter Papst Sixtus IV. (1471-1484) im Jahr 1475 in Rom geprägt wurde. Die Päpste ließen sie für fast ein Jh. zunächst neben dem Dukat, später neben dem Scudo d'oro prägen, zuletzt Papst Pius V. (1566-1572). Der Fiorino di camera zeigt meist auf der Vs. Wappen, in der Spätzeit auch die Büste des Papstes, auf der Rs. Petrus im Schiff, manchmal auch Christus und Petrus oder 2 Apostel im Schiff, vor allem bei Mehrfachstücken....
Fischgeld
Früher wurde auf Island, Neufundland und gelegentlich auch in einigen Gebieten Skandinaviens und Kanadas Fisch in getrockneter Form (Stockfisch) als Naturalgeld verwendet. Auf Island wurde der 96. Teil der dänischen und norwegischen Speciestaler als "fisk" bezeichnet.
Fischmünzen
1. Kleine antike Bronzemünzen in Form von Delfinen aus dem 5./6. Jh. v. Chr. der griechischen Stadt Olbia am Schwarzen Meer. Vermutlich handelt es sich aber dabei nicht um Münzen, sondern um Marken.
Delfinförmige Bronzemünze von Olbia
2. Aus China stammen sog. Fischmünzen, fischförmige Bronzeobjekte aus der Zhou-Dynastie (770-221 v. Chr.), die zu den pseudomonetären Geldformen gehören, denn ihr Gebrauch als Zahlungsmittel ist durch nichts bewiesen, obwohl s...
Flabbe
Billonmünze zu vier Stuiver oder Stüber aus den Städten Deventer und Groningen seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s mit einem Raugewicht von 4,1 g (483/1000 fein). Sie zeigt auf der Vs. ein Blumenkreuz, auf der Rs. den Adlerschild.
flan bruni
Französische Bezeichnung für den Erhaltungsgrad „Polierte Platte (PP)“. Flan aus dem lateinischen flare (gießen) bezeichnet im Französischen den Schrötling oder das Münzplättchen.
Fledermaus
Spottname für eine Reihe deutscher Kleinmünzen, von der Bevölkerung meist nach den missglückten Darstellungen der Adler auf dem Gepräge benannt. Beispielsweise zeigten die schlesischen Gröschel und Dreikreuzer und die preußischen Dreigröscher Adlergebilde, die Fledermäusen glichen. Auch einige Stempelschnitte des Nesselblatt-Motivs, z.B. auf den Wappenbildern von Holstein und Schaumburg, gaben Anlass zu solchen Interpretationen. Ein Typ des Moritzpfennigs aus der Münzstätte Halle soll...
Fleißtaler
Bezeichnung für Prämienmedaillen und -münzen in Talerform, die im 17.-19. Jh. zur Belohnung oder als Auszeichnung vergeben wurden. Sie wurden meist im gleichen Gewicht wie die offiziellen Taler geprägt, gelegentlich auch als Doppel- oder Halbstücke. Dazu zählt z.B. der unter König Anton von Sachsen 1829 geprägte Taler für die königliche Bergakademie zu Freiberg, der auf der Rs. im Lorbeerkranz die Aufschrift DEM/FLEISSE zeigt, darunter zwei gekreuzte Hämmer. Ein Jahr später ließ der...
Fleur de coin
Französische Bezeichnung für den Erhaltungsgrad „Stempelglanz“, abgekürzt FDC.
Fleur de lis
Ein Typ, der im Mittelalter weite Verbreitung fand, so auf dem Floren und dem Gigliato. Der Ausdruck stammt aus dem Französischen und bedeutet Lilienblüte. In Frankreich tauchen die fleurs de lis, die wenig Ähnlichkeit mit der Blume (Lilie) haben - häufig auch ornamental - auf Münzen seit dem 13. Jh. auf. Seit Philipp VI. (1328-1350) auch auf dem Landesschild (drei Lilien), bis ins 19. Jh.
Flimmerchen
Ursprünglich volkstümliche Bezeichnung aus dem 17. Jh. für kleine Billonmünzen (Pfennige und Heller) im Kurfürstentum Trier, die unter Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen (1652-1676) geschlagen wurden. Verkleinerungsform von Flimmer in der Bedeutung von Glänzendem, Glitzerndem. Im 18. Jh. ging die Bezeichnung auf die kupfernen Halbkreuzer oder 2-Pfennig-Stücke über. Auch die seit 1873 geprägten kleinen silbernen 20-Pfennig-Stücke des Deutschen Reichs wurden Flimmerchen genannt.
Flindrich
Volkstümliche niederdeutsche Bezeichnung für ostfriesische, oldenburgische und Jeversche Groschenmünzen im Wert von drei Stübern. Da die Münzen ursprünglich auf sehr dünnen und breiten Schrötlingen geprägt wurden, leitet sich das Wort vermutlich aus Flidder( Flitter) ab. Auch Ableitungen vom englischen Wort "flinder" (Placken oder abgebrochenes Stück) oder von Flügel bzw. "Flieger" sind schon genannt worden, letzteres wegen der Harpyie (vier...
Flitter
1. Bezeichnung kleiner kupferner Halbpfennigstücke, die in Niedersachsen und Thüringen während der Kipper- und Wipperzeit ausgegeben wurden. Es gab auch 2-, 3- und 4-Flitter-Stücke.
2. Ursprünglich Bezeichnung für kleine vergoldete Messingplättchen, die mit Sternen und anderen Ornamenten versehen waren. Nach Schrötter wurden sie von den Nürnberger Flinderleinschlägern hergestellt. Sie dienten zur Verzierung von Hochzeitshauben und wurden bei Hochzeiten in Türeingänge und auf Wege ges...
Floaten
Moderner währungstechnischer Begriff für das freie Schwanken der Währungen im Verhältnis zueinander. Sie können einzeln oder in Gruppen untereinander "floaten". Ursprünglich bedeutet das englische Wort "im Wasser treiben". Das Floaten ist eng mit dem Scheitern des Währungssystems verbunden, das 44 alliierte Staaten ausgangs des 2. Weltkriegs (1944) in Bretton Wood (USA) beschlossen hatten. Danach sollten die Währungen in festen Paritäten zueinand...
Flóirin
Irische Bezeichnung des silbernen Floren zu 2 Scilling (Shilling), der in Irland von 1928 bis zur Einführung des Dezimalsystems 1971 ausgegeben wurde. Der Flóirín wurde von 1928 bis 1943 in 750er Silber im Gewicht von 11,3104 g ausgegeben, 1951-1968 in Kupfer-Nickel. Er zeigt auf der Vs. die Irische Harfe mit der Landesbezeichnung, anfangs SAORSTAT EIREANN (Irischer Freistaat), seit 1939 EIRE (Irische Republik). Die Rs. zeigt den Atlantischen Lachs, die Nominalbezeichnung in der irischen Land...
Floren
Die wohl bedeutendste Goldmünze des Mittelalters. Sie wurde ab 1252 in der Republik Florenz geschlagen. Seit ca. 500 Jahren gab es damals in Mittel- und Westeuropa nur Silbermünzen, lediglich in Süditalien, Sizilien und Spanien wurde (vorwiegend unter arabischem und byzantinischem Einfluss) auch Gold gemünzt (z.B. Solidus, Augustalis, Tari). Durch den Ausbau des seit den Kreuzzügen begonnenen Handels mit der Levante strömte regelmäßig genügend Gold nach Florenz, um eine eigene Goldpräg...
Florette
Französische Groschenmünze zu 20 Deniers tournois, die von König Karl (Charles) VI. (1380-1422) im Jahr 1417 als Silbermünze im Raugewicht von 3,4 g (666/1000 fein) eingeführt wurde. Seine Vs. zeigt die Krone über drei Lilien, die Rs. das Lilienkreuz. Zunächst als Dauphin (Thronanwärter) und seit 1422 als König ließ sein Nachfolger, Karl (Charles) VII. (1422-1461), im Silbergehalt verschlechterte Billonmünzen folgen, zuletzt 2,44 g schwer ...
Florin
1. Französische, spanische und englische Bezeichnung für den goldenen Floren und dessen Nachahmungen. Die letzten französischen Florins wurden bis ins beginnende 17. Jh. von dem Grafen Charles II. Gonzague (1601-1637) von Rethel an der Aisne (Champagne) und von den Bischöfen von Verdun geprägt.2. Die sehr seltenen englischen Nachprägungen des Florin, Halbflorin (Leopard) und Viertelflorin, werden nach ihren heraldischen Darstellungen auf den Vs.n als Double Leopard,Leopard und Helm bezeich...
Flosupeningr
Zeitgenössische norwegische Bezeichnung für einseitige Prägungen( Brakteaten), die zwischen 1100 und 1350 v. Chr. in Norwegen hergestellt wurden. Mit einem Gewicht bis zu unter einem Gramm (0,06 g) zählen sie zu den dünnsten und leichtesten Münzen weltweit. Das Wort bedeutet etwa Schuppenpfennige (von Flosu = Schuppe).
Flötner, Peter
Bildschnitzer, Plakettenkünstler, Kunsttischler und Holzschneider. Aus der frühen Zeit des Künstlers ist nur wenig bekannt. Vermutlich stammte Flötner aus Thurgau. Es wird angenommen, dass er seine Lehrzeit in Augsburg verbrachte und sich anschließend in Italien aufhielt. Vermutlich ließ er sich um 1523 in Nürnberg nieder. Der vielseitige Künstler schnitt Reliefs in Stein und Holz, entwarf Architekturteile, Möbel, Geräte, Schmuckfassungen und Ornamente. Seine Modelle schnitt er bevorzu...
Flussgolddukaten
Rheingolddukaten
Ausbeutemünzen im weiteren Sinn, geprägt aus dem Gold, das aus dem Sand des jeweiligen Flusses in aufwendigen Verfahren gewonnen wurde. In Deutschland stammen die Flussgolddukaten des 17.-19. Jh.s aus den Flüssen Rhein, Donau, Eder, Isar, Inn und Schwarza. Die Gepräge zeigen auf dem Münzbild den betreffenden Fluss, die Beschriftung macht deutlich, um welchen Fluss es sich handelt. Die Rheingolddukaten zeigen meist rv. Städtebilder (Mannheim, Speyer) mit dem Fluss im Vorder...
Flussgötter
Flüsse wurden von den alten Griechen wegen des Fruchtbarkeit spendenden Wassers als Ernährer der Jugend, auch übertragen als Spender der Kultur und als Stammväter der Adelsgeschlechter verehrt. Wie die Meergottheiten wurde den Flussgöttern die Fähigkeit zugesprochen, ihre Gestalt zu verwandeln. Sie kommen häufig in Gestalt von Tieren (z.B. Stier, Schlange), Menschen oder in Mischformen (z.B. Stier mit gehörntem Menschenkopf) vor. Personifizierte Darstellun...
Follaro
Kupfermünze Süditaliens nach dem Vorbild des byzantinischen Follis. Seit dem 7. Jh. v. Chr. ließen die Herzöge und Prinzen von Beneventum kupferne Follari in Gaeta, Neapel und Sorrent, die Langobarden in Capua, Salerno und Sorrent schlagen. Nach der Eroberung Süditaliens und (später) Siziliens setzten die Normannen die Prägung fort. Es gab auch Halb- und Dreifachstücke, letztere wurden unter König Roger (Ruggero) II. (1130-1154) in konkaver Form mit einem Gewicht von ca. 10 g in Palermo...
Follis
Reduzierter Follis
1. Römische Scheidemünze der späten Kaiserzeit, die im Rahmen der groß angelegten Münzreformen des Kaisers Diokletian (294-305 v. Chr.) im Gewicht von ca. 10 g mit einem Durchmesser von ursprünglich ca. 28 mm eingeführt wurde. Der Name Follis bedeutet ursprünglich "Beutel" und hat sich vermutlich über die Bedeutungsverschiebung auf den Inhalt des Beutels als Bezeichnung für eine fest abgezählte Menge an Kleingeld eingebürgert. Der Follis ist eine kupferreiche Bronz...
fondo specchio
Italienische Bezeichnung des Erhaltungsgrades „Polierte Platte (PP)“, abgekürzt FS.
Forint
Der Forint (Währungskürzel HUF) ist die offizielle ungarische Währungseinheit seit dem 1. August 1946. Ein Forint unterteilt sich hierbei in 100 Fillér, wobei der kleineren Währungseinheit seit Ende der 1990er kaum Bedeutung mehr zugeschrieben wird. Von 1857 bis zur Einführung der Kronenwährung (Korona, Pengö) 1892 galt der silberne Forint im ungarischen Königreich unter der Habsburger kaiserlichen und königlichen Monarchie 100 Krajzer, in Entsprechung zum österreichischen Gulden zu 1...
Formsand
Feuerfester Sand zur Formgebung des Metalls, bei der Münzherstellung lange Zeit zur Formung der Zaine verwendet, je nach Materialbeschaffenheit und Stand der Technik. Bis ins 19. Jh. wurde dafür eine Mischung aus porösem Sand, Asche und Bierhefe hergestellt. Heute bestehen die Gussformen der Münzen meist aus Eisen. Formsand wird heute nur noch zur Herstellung von Formen bei Medaillen verwendet, z.B. als gebrannte Mischung ausSchamottemehl und Gips.
Formular
Papiergeldkundlicher Ausdruck für amtliche Veröffentlichungen als Ankündigung über die Ausgabe eines neuen Geldscheins. Diese Vorabveröffentlichungen zeigen vereinfachte Darstellungen des künftigen Scheins oder Billets. Wenn keine Geldscheine mehr erhalten sind, wie z.B. bei den Wiener Bankozetteln, ist die Numismatik auf die Formulare angewiesen.
Fort d'or
Samson d'or
Sehr seltene Goldmünze, die Herzog Karl (Charles) von Aquitanien (1468-1474), Bruder des französischen Königs Ludwig (Louis) XI. (1461-1483), als einzigartigen Typ schlagen ließ. Die Vs. zeigt den stehenden Herrscher, den englischen Leoparden bezwingend, auf der Rs. ein Blumenkreuz mit geviertem Schild, das je zweimal die Wappen von Frankreich (3 Lilien) und England (Leopard) zeigt. Die lat. Umschrift lautet: FORTITUDO MEA ET LAUX (!) MEA TU ES DOMINE DEUS MEUS (Meine Stärke und...
Fortuna
Römische Göttin des Glücks und des zufälligen Schicksals, mit der griechischen Göttin Tyche gleichgesetzt. Auf römischen Münzen der Republikzeit wurde schon früh das Kopfbild der Fortuna dargestellt. In augusteischer Zeit wuchs ihre Bedeutung: Als Fortuna redux wurde ihr ein Altar errichtet, der die Freude des Volks über die Rückkehr des Augustus ausdrücken sollte. Plinius d. Ä. nennt sie in seiner Naturalis historia (nat. 2,22) die einzige Gottheit für viele, was auf ihre Beliebthe...
Fractionel Currency
Kleingeldscheine zu 3, 5, 10, 25, und 50 Cents, die aufgrund des Kleinmünzenmangels während des nordamerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865) ausgegeben wurden. Nach der ersten Emission der Postage Currency legalisierte der Kongress am 3. März 1863 die Emission der Postal Currency und autorisierte die folgenden Emissionen. Am 10. Oktober 1863 begann die zweite Emission, die fünfte und letzte Emission erfolgte vom Februar 1874 bis zum 15. Februar 1876.
Franc d'argent
Französische Silbermünze, die 1575 unter Heinrich (Henri) III. (1574-1589) als schwererer Nachfolger des Teston mit einem Raugewicht von 14,188 g (833/1000) eingeführt wurde. Das Münzbild zeigt auf der Vs. das Porträt des Königs, auf der Rs. das H (für Henricus) im Blumenkreuz. Seine Nachfolger ließen weitere Einfach-, Halb- und Viertelstücke folgen. Heinrich IV. (1589-1610) ließ das Gewicht des Franc noch einmal erhöhen, bevor Louis XIII. (1610-1643) zum Ende seiner Regierungszeit sc...
Franc d'or
Franc a cheval, Franc a pied, Franco
1. Im Jahr 1805 übergab Napoleon Bonaparte seiner Schwester Elisa Bacciochi das in der Toskana gelegene Lucca als Fürstentum. Die Herrscherin veranlasste daraufhin die Prägung von Silbermünzen in Entsprechung zum französischen Franc, die zeitgenössisch Franchi genannt wurden. Auch Silberstücke zu 5 Franchi mit den Büsten von Elisa und Felix Bacciochi wurden geprägt.2. Landessprachliche Bezeichnung der Währungseinheit von Äquatorialguinea seit dem B...
Franceschino
Die Verkleinerungsform von Francescone bezeichnete die Halbstücke der silbernen Scudi des 18./19. Jh.s in der Toskana.
Francescone
1. Beiname des silbernen Scudo, den Großherzog Francesco I. (1574-1587) in der Toskana einführte.2. Beiname des silbernen Scudo zu 10 Paoli, den Herzog Franz Stephan von Lothringen (Francesco III.) zu Beginn seiner Regierungszeit (1737-1765) in der Toskana einführte. Auch die nachfolgenden Scudi behielten den Namen Francescone bis in die Mitte des 19. Jh.s bei. Es gab auch Halbstücke, die diminutiv Franceschini genannt wurden.
Francescone (10 Paoli) 1748
Franciscus
Beiname des Dizain zu 10 Deniers, der unter dem französischen König Franz (François) I. (1515-1539) geprägt wurde. Der Franciscus zeigt auf der Vs. ein großes F, auf der Rs. ein Kreuz mit 4 Lilien.
Francofurtia
oder Francofordia ist die weibliche Personifikation der Stadt Frankfurt (Main), auf Vereinstalern und Doppeltalern der Stadt zwischen 1857 und 1866 dargestellt. Sie zeigen auf der Vs. die Büste, zu der die Schauspielerin Janauschek Modell gesessen hat. Der Medailleur August von Nordheim signierte die Münzen mit A. v. Nordheim. Die Signatur wurde als Anna von Nordheim gedeutet, angeblich eine Geliebte von Baron von Rothschild, der Einfluss auf das Münzwesen der Freien Stadt Frankfurt hatte.
&n...
Francois d'or
Beiname der Doppeldukaten, die Herzog Franz (François) III. Stephan(e) im letzten Regierungsjahr 1736 für Lothringen prägen ließ. Sie zeigen die Büste des Herzogs auf der Vs., auf der Rs. das gekrönte Wappen, von zwei Adlern gestützt.
Frang
Moselfränkische Bezeichnung für den luxemburgischen Franc, ausgeschrieben auf 5-Francs-Stücken von 1949 und auf Papiergeld der Luxemburger Währung.
Franka Ar
Auch Frang(a) (Ar), war die Münzeinheit Albaniens, die Präsident Amet Zogu (seit 1928 König) im Jahr 1925 als Münzeinheit nach dem Vorbild des Franken der Lateinischen Münzunion einführte. Obwohl Ar eigentlich Gold bedeutet, wurden auch die silbernen 1-, 2- und 5-Franka-Stücke, ebenso wie die goldenen 10- bis 100-Franka-Stücke gelegentlich mit dem Zusatz "Ari" (Plural von Ar) versehen. Parallel dazu gab es die Lek-Währung (5 Lek = 1 Frank), die durch den Anschluss an Italien 1939 in Par...
Franken
Offizielle Bezeichnung für den schweizerischen Franc seit 1850. In Deutschland wurde früher auch der französische Franc als Franken bezeichnet, besonders im Zusammenhang mit der Währung der Lateinischen Münzunion. Auch die saarländischen Münzen von 1954/55, die in Gewicht, Durchmesser und Legierung genau den gleichwertigen französischen Stücken zu 10, 20, 50 und 100 Francs entsprachen, sind mit der Bezeichnung FRANKEN versehen. Am 6. Mai 1959 trat die Deutsche Mark im Saarland als Währ...
Frankfurter Judenpfennige
Halbac, Atribuo, Judenpfennige
Bezeichnung für illegale Kupfermünzen, die zu Beginn des 19. Jh.s im Währungsbereich des rheinischen Guldens, vor allem wohl im Frankfurter Raum in großen Mengen zirkulierten. Die Benennung hat sich durch die Vermutung eingebürgert, die Scheidemünzen seien in der Umgebung Frankfurts von Juden geprägt worden, ein Teil des Kleingelds stammt auch aus privaten Prägeanstalten und könnte aus den Niederlanden oder England eingeschmuggelt worden sein. Die tatsäch...
Fränkische Heller
Sammelbezeichnung für die Ansbacher, Bamberger, Bayreuther und Würzburger kupfernen Heller des 17./18. Jh.s. Wie die Coburger und Saalfelder Heller zirkulierten auch die Fränkischen Heller im Wert eines halben Pfennigs außerhalb von Franken.
Fränkischer Kreis
Zum Fränkischen Kreis des alten Römisch-Deutschen Reichs (Reichskreis) zählen die Münzstände der Bistümer Bamberg, Eichstätt und Würzburg, der Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg, Schweinfurt, Weißenburg (am Sand) und Windsheim. Ferner die Markgrafschaften von Brandenburg-Ansbach und -Bayreuth, die zerstückelten Grafschaften von Henneberg im Besitz verschiedener Herzöge und Kurfürsten der sächsischen Linien sowie die Münzstände verschiedener Linien des Hauses Hohenlohe und der Gra...
Franklin Half Dollar
US-amerikanisches silbernes Halbdollar-Stück zu 50 Cent, das zwischen 1948 den Typ Walking Liberty ablöste. Die Vs. zeigt die Büste Benjamin Franklins (1706-1790), auf der Rs. findet sich die Darstellung der gesprungenen Freiheitsglocke (Liberty Bell). Einige Stücke aus dem Jahr 1955 zeigen einen durch einen kleinen Stempelsprung verursachte Verunstaltung am Mund Franklins. Sie werden in Sammlerkreisen Bugs Bunny Halves genannt. Der zuletzt 1963 geprägte Typ wurde durch den Kennedy Half Dol...
Franz-Joseph d'or
Bezeichnung der österreichisch-ungarischen Goldmünzen im Wert von 8 Gulden (Forint) bzw. 20 Franken und 4 Gulden (Forint) bzw. 10 Franken, die der Doppelmonarch Franz Joseph (1848-1916) in den Jahren 1870 bis 1892 in Frankenwährung prägen ließ. Sie zeigen auf der Vs. den bekränzten Herrscher mit Backenbart. Bereits am 31. 8. 1867 hatte der Monarch einen Vorvertrag (Präliminarkonvention) mit Frankreich vereinbart, der die Einführung der Goldwährung un...
Französischer Franc
Bei dem Französischen Franc handelt es sich um die Währung Frankreichs, die von der Französischen Revolution bis zur Euroeinführung (1795-2002) im französischen Zahlungsverkehr im Umlauf war. Während mit der Bezeichnung „Französischer Franc“ meist diese Währung Frankreichs der Jahre 1795 bis 2002 gemeint ist, wird die Bezeichnung auch für den spätmittelalterlichen Franc d’or und den Franc d’argent des 16. und 17. Jahrhunderts verwendet.
Eckdaten des Französischen Francs
Mer...
Franztaler
Auch Franzgeld, war im 18. Jh. die volkstümliche Bezeichnung für den aus Frankreich stammenden Ecu blanc, der in Form der Ecus neufs oder Ecus à six livres und ihrer Teilstücke in der Mitte des 18. Jh. zum Hauptkurantgeld im Westen und Südwesten Deutschlands sowie in Preußen wurde. In der zweiten Hälfte des Jh.s blieb der Franz- oder Laubtaler die Haupthandelsmünze Deutschlands.
Frauengeld
Bezeichnung für das von den Insulanern der mikronesischen Inselgruppe Yap (Westkarolinen) selbst als "Yar" bezeichneten Muschelgelds. Es besteht aus den Schalen der Großen Seeperlmuschel, die innen charakteristisch perlmutten glänzen. Sie wurden als Zahlungsmittel und Schmuck genutzt. Das einzigartige Steingeld auf Yap war nur den Männern vorbehalten, während sich die Frauen des Muschelgelds bedienten, das deshalb als Frauengeld bezeichnet wird. Die Muschelschalen wurde...
Frederik d or
Seltene dänische Goldmünze im Wert von 5 Speciestaler mit einem Raugewicht von 6,64 g (896/1000), die König Frederik VI. (1808-1839) im Jahr 1826 als Doppelstück einführte, ein Jahr später folgten auch Einfachstücke. Sie zeigen av. den Kopf des Königs, rv. die Wertbezeichnung mit Jahresangaben bzw. das gekrönte Wappen mit Wertbezeichnung und Datum. Die Doppelstücke der Jahrgänge 1836-1839 zeigen den von zwei Wilden Männern gehaltenen gekrönten Landesschild. König Christian VII. (18...
Frederiker
Beiname der schwedischen Caroliner (Carolin) aus der Regierungszeit König Frederiks I. (1720-1751). Die Münze ist nach dem schwedischen König benannt, dessen Kopfbild auf der Vs. zu sehen ist.
Freiberger Zinsgroschen
Groschenmünzen aus dem Silber der Schneeberger Gruben im Erzgebirge, die 1496 und 1498-1500 mit einem Feingehalt von ca. 480/1000 in Freiberg, Leipzig und Schneeberg in großen Mengen geschlagen wurden. Sie wurden zum Vorbild der bedeutenden Freiberger Groschenprägung. Mit dem Antrag auf Erteilung des Bergbaurechts ("Mut") an einem bestimmten Ort musste der Antragsteller einen Groschen (Mut- oder Zinsgroschen) bezahlen. Grundsätzlich war jede Person berechtigt, beim Bergamt z...
Freies Prägerecht
Das Recht von Privatpersonen, das Währungsmetall vorgegebener Feinheit gegen Erstattung der Prägekosten in Währungsmünzen ausprägen bzw. bei Übernahme der Einschmelzungskosten in Barren zurückverwandeln zu lassen. Von einigen Ausnahmen abgesehen, galt dieses Recht bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. So hatte z.B. die Sperrung des freien Prägerechts (1873) für 5-Franken-Stücke in der Lateinischen Münzunion die Wirkung, dass sich der Wert de...
Freiheitsmütze
Die Mütze der phrygischen Fischer wurde von den Jakobinern während der Französischen Revolution zum Freiheitssymbol erhoben und ist als Kopfbedeckung auf den frühen Centime- und Décime-Stücken zu sehen.
Freimaurermedaillen
Auch Logenmedaillen, wurden auf Ereignisse (Gründung und Jubiläum) und Personen (Ehrung von Stiftern und Meistern) geschlagen, die im Zusammenhang mit Freimaurerlogen stehen. Eine der ersten Freimaurermedaillen wurde 1733 auf Sackville, den Stifter der Loge von Florenz, geschlagen. Obwohl im 18. Jh. viele Großlogen gegründet wurden, wurden in dieser Zeit nur selten Freimaurermedaillen geprägt. Erst im 19. Jh. treten die Medaillen häufig auf, wohl im Zusammenhang mit der zunehmenden Mitglie...
Freundschaftsmedaillen
Sammelbezeichnung für Medaillen, die sich in Schrift oder Bild auf die Freundschaft beziehen. Sie entstanden in der Mitte des 16. Jh.s und erlebten ihre Blütezeit im ausgehenden 17. Jh. sowie unter dem Einfluss der Romantik und des Biedermeier auch in der ersten Hälfte des 19. Jh.s. Bekannte Medailleure wie G. Hautsch (Nürnberg), P. H. Müller (Augsburg), C. Wermuth (Gotha), J. Kittel (Breslau), D. F. Loos (Berlin) u.a. stellten Freundschaftsmedaillen her. Interessanterweise fand das Phänom...
Friedenskreuzer
Badische Kupferkreuzer, die Großherzog Friedrich (1872-1907) auf die Friedensfeier von 1871 prägen ließ. Sie zeigen auf der Vs. das gekrönte badische Wappenschild von zwei Greifen gehalten, auf der Rs. einen strahlenden Stern über der Inschrift FRIEDENSFEIER 1871, darunter die Friedenstaube.
Baden, Friedenskreuzer 1871
Friedensmünzen / Medaillen
Ausgaben, die den Wunsch nach Frieden ausdrücken oder auf einen Friedensschluss geprägt sind. Erstere wurden am häufigsten während des Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) geprägt (z.B. Nürnberger Friedenswunsch-Dukaten), letztere auf den Westfälischen Frieden (z.B. Schautaler von Münster). Auch im 18. Jh. und zu Beginn des 19. Jh.s gab es zahlreiche Friedensprägungen, z.B. die Taler, die der Markgraf von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth auf den Frieden zu Teschen (1779) prägen ließ. Auch...
Friedrich d'or
Bezeichnung für die Pistole (5-Taler-Goldmünze), die unter König Friedrich II. (dem Großen, 1740-1786) eingeführt und deren Prägung von seinen Nachfolgern Friedrich Wilhelm II. 1786-1797), III. (1797-1840) und IV. (1840-1861) weitergeführt wurde. Die Pistolen nach spanischem (Escudo de ouro) und französischem (Louisd'or) Vorbild wurden in mehreren deutschen Staaten eingeführt. In Preußen gab es zuerst Doppelpistolen (Wilhelm d'or) und deren Halbstücke in den letzten drei Regierungsjah...
Friedrich-Franz d'or
Pistolen (5-Taler-Goldmünzen), die Friedrich Franz I. als Großherzog (1815-1827) von Mecklenburg-Schwerin (zuvor Herzog von 1785 bis 1815), in den Jahren 1828, 1831-1833 und 1835 prägen ließ. Die Vs. zeigt den Kopf des Herrschers n. links, die Rs. das bekrönte Wappen mit Jahreszahl und Wertangabe. Es gibt auch Halb- und Doppelstücke.
Friedrich-Wilhelm d´or
Irrtümliche Bezeichnung der Friedrich d'ors, die unter den preußischen Königen Friedrich Wilhelm II., III. und IV. von 1786 bis 1855 geprägt wurden. Da auch die doppelt so schweren Wilhelm d'ors unter Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) gelegentlich so bezeichnet wurden, kam es zu Irrtümern.
Friesacher
Beliebte mittelalterliche Silbermünzen, die nach der Stadt Friesach in Kärnten benannt sind. In der Nähe eines Silberbergwerks errichteten dort die Salzburger Erzbischöfe um 1125 eine Münzstätte und begannen den Schlag eines 15-lötigen Silberpfennigs mit einem Durchschnittsgewicht von 1,22 g. Das Münzbild zeigt in der 2. Hälfte des 12. Jh.s am häufigsten den Erzbischof auf der Vs. und zwei Kirchturmspitzen im Perlkreis auf der Rs. Im Vergleich zu...
Friktionsspindelpresse
Weiterentwicklung des Spindelprägewerks durch ein Schwungrad und zwei rotierende Friktionsscheiben, die sich am oberen Ende des Spindels befinden. Sie dienen der Erzeugung des Pressdrucks bei der Prägung. Das sich über ein Gewinde abwärts bewegende Spindel mitsamt Stößel wird dadurch angetrieben. Die Friktionsspindelpresse erreichte eine bessere Regulierbarkeit und Gleichmäßigkeit des Drucks als der Balancier, den sie in der Medaillenprägung ersetzt...
Fuang
Siamesische Silbermünze nach europäischem Vorbild, die König Chom Klao (Rama IV., 1851-1868) einführte. Der König ließ sie mit der importierten Münzpresse der Firma Taylor & Challen Ltd. (Birmingham) prägen, die er im Jahr 1860 in Bangkok installieren ließ. Damit gehörte das heutige Thailand zu den ersten Ländern Fernasiens, das die moderne Münzprägung einführte. 8 Fuang = 1 Baht (Tikal). 1 Fuang = 8 Att. Die letzten Fua...
Fuchs
Auch Foss, sind volkstümliche Bezeichnungen für kupferne Kleinmünzen des 17./18. Jh.s im Gebiet von Nordrhein und Westfalen. Die Benennung leitet sich von der roten Kupferfarbe der Münzen ab. Dazu zählen z.B. die 3-Pfennig-Stücke der Städte Hamm und Soest aus der 1. Hälfte des 17. Jh.s, die bergischen Viertelstüber aus der Münzstätte Düsseldorf aus der 2. Hälfte des 18. Jh.s usw.
Fugger
Das Geschlecht der Fugger ging aus einer Barchentweber- und Tuchhändlerfamilie hervor, die seit 1367 in Augsburg ansässig war. Jakob I. Fugger gründete das Fuggersche Handelshaus, das bereits unter seinen Söhnen ein bedeutendes Vermögen erwarb. Das Unternehmen engagierte sich im Montanbereich (vor allem Silber- und Kupferbergbau) und im Bereich des Handels mit Waren (vor allem Gewürze). Der jüngste der drei Söhne, Jakob II. (1459-1525), wurde bereits "der Reiche" genannt. Die Familie erw...
Fugio-Cent
Franklin Cent
Erste offizielle Münze der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), die auf Veranlassung des Kongresses im Jahr 1787 ausgegeben wurde. Zuvor gab es schon Prägungen von Einzelstaaten. Die Kupfermünze zeigt auf der Vs. oben eine Sonne, die ihre Strahlen auf eine Sonnenuhr darunter wirft, Umschrift FUGIO (wörtlich " ich fliehe", gemeint war wohl "die Zeit fließt") und die Jahresangabe 1787. Darunter im Abschnitt MIND YOUR BUSINESS (Denk an Deine Aufgabe). Die Rs. zeigt eine aus 13 ...
Fun
Kleines koreanisches Münznominal von 1892 bis 1902. 100 Fun = 1 Yang. Der Typ zeigt av. einen Drachen im Perlkreis und rv. die Wertangabe (in chinesischen Schriftzeichen) im Kranz. Es gibt einige Varianten.
Fundexemplar
Bezeichnung in Auktionskatalogen und in Verkaufslisten für Münzen, die aus Bodenfunden stammen. Ihre Oberflächen weisen gelegentlich Beläge von Schwefel- oder Chlorsilber und Korrosionsspuren auf.
Fünfer
1. Kleine schweizerische Billonmünzen zu 5 Hellern, die in vielen Städten der Schweiz, beispielsweise Bern, Lausanne, Zürich, Solothurn u.a., vom ausgehenden 14. bis ins beginnende 16. Jh. im Wert eines Drittelplappart ausgegeben wurden. Der Berner Fünfer z.B. hatte im Jahr 1496 ein Raugewicht von 0,94 g (277/1000 fein).
2. Bezeichnung für die 5-Kreuzer-Stücke, die nach dem Konventionsfuß von 1753 im süddeutschen Raum in großen Mengen geschlagen wurden. Da der Konventionsfuß für die ...
Fünferlein
Bezeichnung des fränkischen Halbschillings, der seit 1495 im Wert von 5 Pfennigen geprägt wurde. Sein Gewicht betrug 1,33 g (406/1000 fein). Die Grundlage zur Prägung des Fünferleins legte der neu geschaffene Münzverein zwischen Friedrich von Brandenburg-Franken (1495-1515), Otto Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern sowie Heinrich von Bamberg . Zwar gab es seit 1457 im brandenburgischen Franken schon einen Halbschilling (lat. medius solidus) mit einem Raugewicht von...
Fünfkreuzer
1. Bezeichnung einer Silbermünze, die als Teilstück des Reichsguldiners zu 60 Kreuzern mit der Augsburger Reichsmünzordnung von 1559 geschaffen worden war, aber 1566 wieder abgeschafft wurde.2. Das 5-Kreuzer-Stück, das nach dem Konventionsfuß von 1753 in Baden, Hessen, Württemberg und in den Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth ausgegeben wurde, auch Fünfer genannt. Die württembergischen Stücke waren mit der Wertangabe "240 EINE FEINE MARK" versehen.
Baden-Durl...
Fünfteltaler
Bezeichnung für die polnischen und preußischen Achtzehngröscher oder Tympfe.
Fünfzehnkreuzer
Bezeichnung für Sechsteltaler (vom Taler zu 90 Kreuzer) oder Fünfböhmer (vom Böhm zu 3 Kreuzern), die in der 2. Hälfte des 17. Jh.s in großen Mengen geschlagen wurden. Sie dienten in den Kriegen (2. Nordischer Krieg, Reunionskriege, Türkenkriege) zur Truppenbesoldung und Beschaffung von Kriegslieferungen. Ihre Prägung wurde von 1659 bis 1665 unter Kaiser Leopold I. (1658-1705) im Römisch-Deutschen Reich veranlasst und von vielen Münzständen in Schlesien, Tirol, Salzburg und Ölmütz n...
Fürstengroschen
1. Die ersten Fürstengroschen wurden wohl zur Regierungszeit des Landgrafen Balthasar von Thüringen (1367-1401) zu 8 Pfennigen ausgegeben. Ihre Vs. zeigt ein Lilienkreuz, die Rs. einen Löwen, die späteren aus der ersten Hälfte des 16. Jh.s den Landsberger Schild. Letztere wurden deshalb auch als Landsberger Groschen oder Schildgroschen bezeichnet; sie galten 12 Heller. Bei stark schwankendem Feingehalt lag ihr durchschnittliches Feingewicht bei ca. 1,6 g Feinsilber.
2. Groschenmünze zu 12 ...
Fyrk
Bezeichnung für eine schwedische Münze, die zum ersten Mal etwa 1478 als kleine Silbermünze im Wert von einem halben Örtug ausgeprägt wurde. Der Fyrk wurde zu 1/6 Öre (4 Penningar) gerechnet. Der Name leitet sich vermutlich von "vierken", einer Verkleinerungsform von "ver" (vier), ab. Die kleine Silbermünze schwankte im Feinsilbergewicht unter 0,3 g bei einem Gesamtgewicht von 1 g und weniger. Etwa zu Beginn der Öreprägung in der ersten Hälfte de...