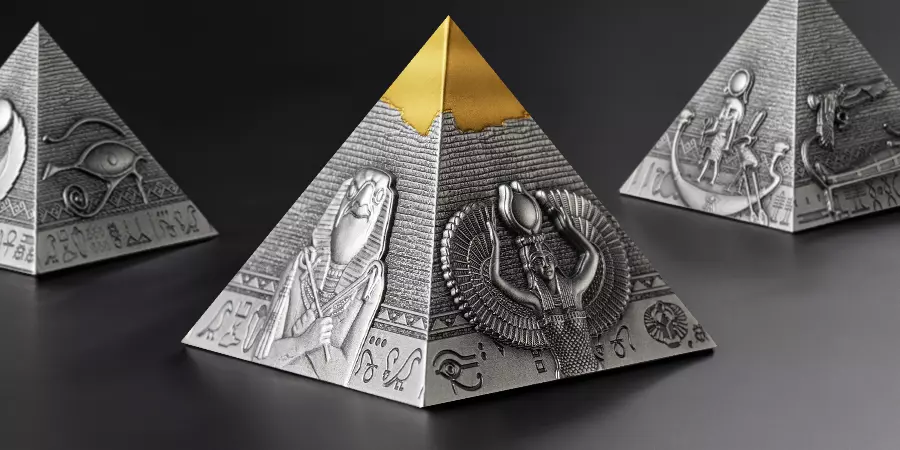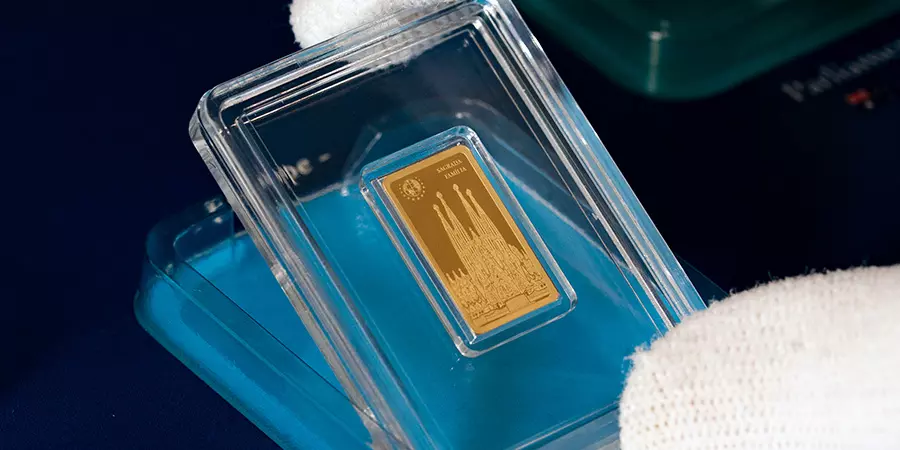Das große Reppa Münzen-Lexikon
Lateinische Münzunion
Die Lateinische Münzunion bezeichnet den zwischen Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz am 23.12.1865 in Paris gegründeten Münzbund. Die offizielle Bezeichnung dieser Währungsunion war ursprünglich Convention Monétaire (Münzvereinbarung). Da aber die Sprachen aller Gründungsstaaten auf dem lateinischen Sprachstamm beruhen, bürgerte sich die Benennung Lateinische Münzunion (frz.: Union Latine) ein.
Die Ziele der europäischen Vereinigung waren zunächst
- die Erleichterung des Zahlungsverkehrs,
- ein gemeinsamer Münzumlauf sowie
- die Beseitigung von Wechselkursschwankungen.
Darüber hinaus war man der Vorbereitung einer Weltwährung auf der Basis des Franken keinesfalls abgeneigt. Napoleon hatte die Hoffnung, mithilfe des Währungsverbunds Kontinentaleuropa beherrschen zu können. So spielten politische Motivationen bei der Gründung der Lateinischen Münzunion durchaus eine Rolle.
Die europäischen Münzen der Mitgliedsländer hatten während dieser Zeit den gleichen Wert. Zu den Münzen der Lateinischen Münzunion zählten unter anderem französische und belgische Francs, Schweizer Franken, griechische Drachmen und italienische Lire. Die eigentliche Währungsmünze, das 5-Frankenstück, war als Silber- und Goldmünze zunächst frei und unbegrenzt ausprägbar. Die Kassen jedes Mitgliedsstaates waren verpflichtet, Goldmünzen und silberne 5-Franken-Stücke der Vertragsstaaten unbegrenzt anzunehmen. Den Umlauf eigenen Papiergelds und fremder Währungen regelte jeder Staat selbst, außerdem gab es keine übergeordnete Kontrollinstanz.
Ursprung und Gründung der Währungsunion
1795 wurde die erste dezimale Währung Europas mit dem Franc zu 100 Centimes von Frankreich eingeführt. Die französische Währung des Franc war ohne Absprachen 1832 von Belgien, 1860 von der Schweiz und 1862 von Italien (auf der Basis der dem Franc angepassten Lira) übernommen worden. Durch den unterschiedlichen Feingehalt der Scheidemünzen (2 Franc bis 20 Centimes) in den verschiedenen Ländern kam es zu Wechselkursschwankungen und Spekulationsgeschäften im Silberhandel. Deshalb wurde die Lateinische Münzunion gegründet.
Die Mitgliedsländer prägten eigene Münzen und hatten eigene Bezeichnungen für diese. 15 Vertragsartikel legten jedoch das Gewicht, den Gold- und Silbergehalt, die Form und Umlaufbedingungen sowie den Nennwert der Goldmünzen und Silbermünzen aller Länder wie folgt fest:
|
Metall |
Nominalwert in Franken |
Gewicht in g | Durchmesser in mm | Feingehalt in Promille |
| GOLD | 100 | 32,2580 | 35 | 900/1000 |
| 50 | 16,1290 | 28 | ||
| 20 | 6,4516 | 21 | ||
| 10 | 3,2258 | 19 | ||
| 5 | 1,6129 | 17 | ||
| SILBER | 5 | 25 | 37 | |
| 2 | 10 | 27 | 835/1000 | |
| 1 | 5 | 23 | ||
| 0,50 | 2,5 | 18 | ||
| 0,20 | 1 | 16 |
Österreich hatte an den vorbereitenden Gesprächen zu dem Münzbund teilgenommen, sich aber lediglich zur Ausprägung von Goldmünzen zu 8 und 4 Gulden im Wert von 20 beziehungsweise 10 Franken entschlossen. Im Jahr 1868 schloss sich Griechenland der Lateinischen Münzunion an. Die Mitgliedschaft blieb auf die fünf europäischen Vertragsstaaten Frankreich, Belgien, Italien, Schweiz und Griechenland beschränkt. Nach 1870 wurde jedoch von den folgenden Ländern teilweise nach den Normen der Frankenwährung geprägt, obwohl sie dem Währungsverbund nie formal beigetreten waren:
- Spanien
- Finnland
- die meisten Balkanstaaten
- einige kleinere europäische Kleinstaaten
- einige Staaten in Mittel- und Südamerika
- die Kolonien der Vertragsstaaten
Frankreich setzte gegen den Widerstand der anderen Länder die Doppelwährung (auch Bimetallismus genannt) durch. Die nach anderen Standards geprägten Scheidemünzen mussten bis zum 1. Januar 1869 aus dem Verkehr gezogen werden, für die schweizerischen 1- und 2-Frankenstücke musste die Frist um neun Jahre verlängert werden.
Der Vertrag begrenzte die Ausmünzung der Scheidemünzen auf 6, später auf 16 Franken pro Einwohner. Auch die Annahme der Silberscheidemünzen war begrenzt. Die Stabilität der Doppelwährung beruhte auf einem festen Wertverhältnis von Gold und Silber (1:15,5). Eine goldene 10-Franken-Münze mit 2,9032 Gramm Feingold entsprach demnach dem Wert von zwei silbernen 5-Franken-Münzen mit 45 Gramm Feinsilber.
Auflösung der Lateinischen Münzunion
Die Währung der Lateinischen Münzunion wurde durch die erheblichen Schwankungen auf dem freien Markt in Mitleidenschaft gezogen. Reiche Goldfunde in Übersee und der Übergang Deutschlands und anschließend anderer Länder zur Goldwährung löste seit etwa 1873 einen dramatischen Preisverfall des Silbers auf dem Weltmarkt aus. Das Wertverhältnis sank und Silber verlor seine monetäre Bedeutung. Die damit verbundenen Probleme konnte die Münzunion nie ganz aus dem Weg schaffen, auch wenn zunächst die Prägung des silbernen 5-Franken-Stückes eingeschränkt und 1878 sogar eingestellt wurde. Damit herrschte praktisch eine hinkende Goldwährung (Doppelwährung und Währung).
Das Außerachtlassen der an Bedeutung zunehmenden Kreditmittel und des Einsatzes von ausländischen Wechseln als Währungsreserve (Golddevisenstandard) wirkte sich für die Währungsunion nachteilig aus. Des Weiteren unterlagen die Mitglieder im Währungsverbund keinen strengen Auflagen. Da diesbezügliche Regelungen im Vertrag fehlten, steigerten Italien und Griechenland den Umlauf von Papiergeld und lösten damit eine Inflation aus.
Sowohl solche inflationären Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts als auch der Erste Weltkrieg, während dessen die Bestimmungen des Münzbundes zeitweise außer Kraft gesetzt waren, verursachten schließlich den allmählichen Verfall der Münzunion. Durch die ungünstigen äußeren Umstände konnten die Ziele der Lateinischen Münzunion längerfristig nie erreicht werden. Offiziell wurde der erste Versuch der Vereinheitlichung des europäischen Münzsystems erst am 1. Januar 1927 beendet.
Die bis dahin größte europäische Währungsunion war damit gescheitert. Erst im Jahr 1999 wurde zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) mit Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien die Europäische Währungsunion von heute gegründet. Im Laufe der Zeit traten weitere Staaten nach Erfüllung der Konvergenzkriterien bei und führten den Euro als gemeinsame Währung ein. Seit ihrer Einführung begeistern Euromünzen Sammler und Numismatiker in ganz Europa.