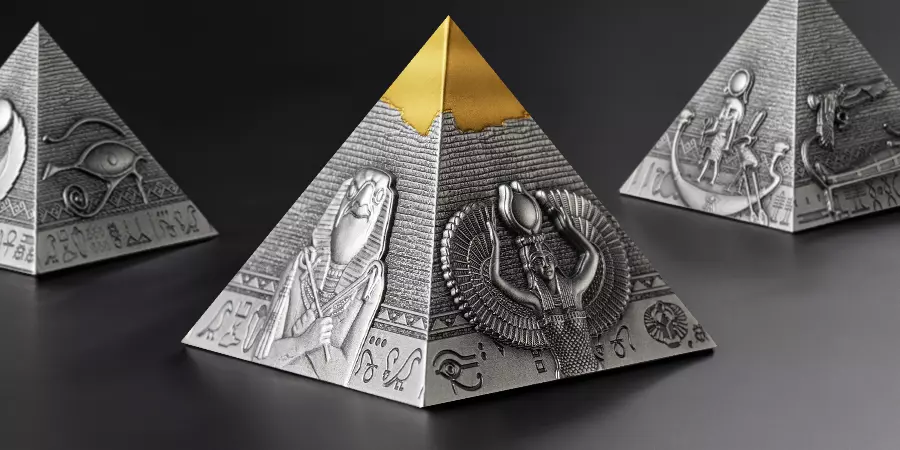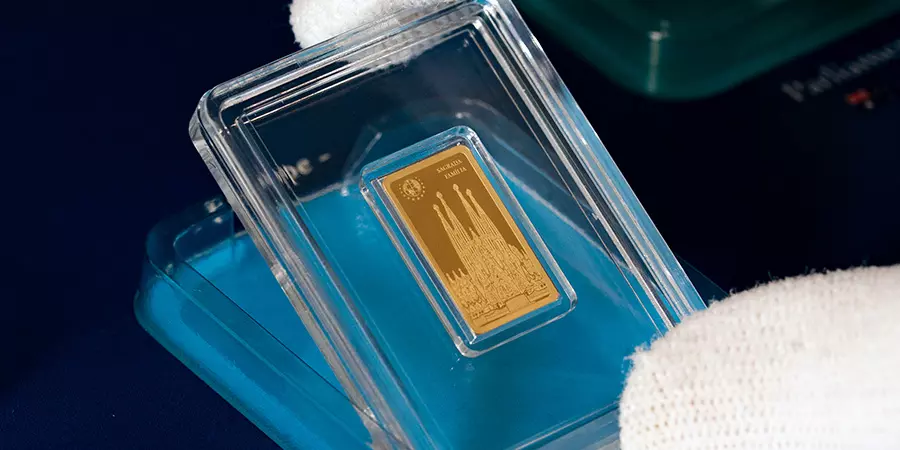Das große Reppa Münzen-Lexikon
M
292 Beiträge in dieser Lexikon KategorieM (Münzstättenzeichen)
Münzbuchstabe der Münzstätten Toulouse (auf französischen Münzen von 1540 bis 1837), Mailand (Milano) auf österreichischen Münzen zwischen 1770 und 1780 und auf italienischen Münzen (bis 1878); Madrid (seit 1591) auf spanischen Münzen, seit 1728 gekröntes M, Mallorca (auch PM oder Diamant), Mexiko (meist mit kleinem o) bis heute, sowie Melbourne auf englischen Sovereigns (1871-1931) und australischen Münzen.
M.B.C.
Abkürzung für den spanischen Ausdruck „muy buena conservación“, der dem Erhaltungsgrad „sehr schön“ entspricht.
Mäander
Vom gleichnamigen, windungsreichen Fluss in Kleinasien (heute Büyük Menderes, Türkei) abgeleitete Bezeichnung für ein rechtwinklig gebrochenes Zierband oder ein fortlaufendes Wellenband. Mäander finden sich als Ornament häufig seit der griechischen Spätantike in der Kunst, auf Schmuck und gelegentlich auf Münzen bis in die Neuzeit.
Mace
Englische Bezeichnung für die chinesische Silbergewichtseinheit, 1/10 des Tael. Im Kaiserreich China waren bis ins ausgehende 19. Jh. die aus verschiedenen Kupferlegierungen gegossenen Münzen mit quadratischem Loch in der Mitte (Ch'ien oder Käsch genannt) im Umlauf. Unter den schwachen Kaisern und zunehmendem Einfluss ausländischer Mächte kam es unter der Münzhoheit der einzelnen Provinzen seit dem ausgehenden 19. Jh. zur Prägung von Silbermünzen nach europäischem Vorbild. Nach Ausrufun...
Macuquina
Spanisch-mexikanischer Ausdruck für „beschnittenes Stück“, englisch Cob genannt. Macuquinas waren unregelmäßig geschnittene Stücke, die das Mutterland Spanien von der Mitte des 16. bis ins 18. Jh. in den süd- und mittelamerikanischen Münzstätten herstellen ließen. In den spanischen Kolonien Amerikas war der Besitz ungemünzten Edelmetalls verboten. Deshalb wurden Gold und Silber möglichst schnell und kostengünstig in den einfach ausgestatteten Münzstätten verarbeitet. Die Schrö...
Macuta
Bezeichnung der portugiesischen Kolonialmünzen, die Portugal für seine Besitzungen in Schwarzafrika herstellen ließ. Der Name soll sich von Stoffgeld aus Raphiafasern ableiten, das im Gebiet von Südangola als Stoffgeld im Umlauf war und von dem portugiesischen Münzgeld nach und nach verdrängt wurde. Die Teilstücke und der ganze Macuta waren aus Kupfer, die Mehrfachstücke (bis 12 Macuta) wurden ursprünglich aus Silber geprägt, seit dem 19. Jh. gab es doppelte und vierfache Macutas aus K...
Madai, David Samuel
Deutscher Numismatiker, veröffentlichte das 3-bändige "Vollständige Thaler-Cabinett" (Königsberg 1765-1767), die umfangreichste Übersicht über die Taler Deutschlands und seiner Nachbarstaaten. In den folgenden Jahren kamen noch drei Nachträge heraus.
Madonnentaler
Marientaler
Als Sammelbezeichnung für Talermünzen zeigen Madonnentaler auf dem Münzbild der Rückseite als charakteristisches Motiv die Mutter Gottes. Geprägt wurden sie mit varierendem Silbergehalt in unterschiedlichen Ländern. Madonnentaler sind sehr selten auch unter den Namen „Marientaler“ oder „Mariataler“ aufgeführt. Im Volksmund wurden sie in Altdeutschland als „Sautaler“ bekannt, da ein Schwein im Verkauf genau dem Wert eines Talers entsprach.
Motiv der Madonnentaler
Da...
Madonnina
Bezeichnung eines in Oberitalien vor allem im 17./18. Jh. verbreiteten Münztyps, der das Motiv der Madonna mit Kind zeigt. Der Madonnina-Typ erscheint vor allem auf seit Mitte des 17. Jh.s geprägten Münzen Genuas, die häufig die Madonna mit Kind auf Wolken als Rückseitenbild tragen. Zu den späteren Madonninas zählen die päpstlichen Kupfermünzen zu 5 Baiocci, die unter Papst Pius XI. (1775-1799) geschlagen wurden.
Magdalin d'or
Provenzalische Goldmünze, die Rene von Anjou (1434-1480) und Charles III. (1480-1482) seit 1476 in den Münzstätten Tarascon und Aix für die Provence ausgaben. Sie ist nach dem Motiv auf der Vs., Maria Magdalena mit Ölgefäß, benannt; die Rs. zeigt das Patriarchenkreuz.
Magermännchen
Zeitgenössischer Spottname für die dünnen und kleinen Viertelstüber, die von 1577 bis 1609 in der Münzstätte Groningen geprägt wurden. Der Name entstand vermutlich in Anlehnung an die Bezeichnung Fettmännchen für die Halbstüber, die zur gleichen Zeit am Niederrhein umliefen.
Magistertaler
Gedenkmünze in Talergröße von 1654 auf die Ernennung des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar zum Rektor der Universität Jena. Beide Seiten zeigen gekrönte Spruchbänder in 2-facher Herzform, im Zentrum Ahnen des Herzogs mit Wappenschilden. Eine Seite zeigt die Büste Johann Friedrichs in der Mitte der deutsch beschrifteten Spruchbänder, die andere die Büsten Johann Friedrichs und Johann Wilhelms.
Maglia
Italienische Bezeichnung für den halben Denaro des Mittelalters, der in Ober- und Mittelitalien selten ausgeprägt wurde, in Entsprechung zum französischen Maille.
Magnesium
Das Metall mit dem chem. Zeichen Mg wurde gelegentlich in geringen Mengen als Zusatz einer Aluminiumlegierung beigegeben, die zur Münzherstellung diente. Nach Berichten soll es teilweise der Hauptbestandteil von Münzen im Ghetto Litzmannstadt gewesen sein( Ghettogeld).
Magnimat
Moderner Münzwerkstoff aus mehrschichtigem Metall, der von der Metallindustrie in Zusammenarbeit mit den Automaten-Münzprüfgeräte-Herstellern und den Münzämtern entwickelt wurde. Die Stücke zu 2 und 5 DM sind aus Dreischichtenwerkstoff hergestellt: Die beiden äußeren Schichten bestehen aus 75% Kupfer und 25% Nickel. Der Kern besteht aus Reinnickel und ist magnetisierbar. Automatenmünzprüfer können die Magnetisierbarkeit als Prüfkr...
Mahmudi
Muhammadi
Auch Muhammadi, ist eine persische Silbermünze des 17. und 18. Jh.s. im Wert von 100 Dinar.
Mail-Bid-Auktion
Postgebotsauktion, Fernauktion
Auch Mail-Bid-Sale (frz. Vente sur offre) wird die Postgebots- oder Fernauktion genannt. Es handelt sich um ein aus den USA stammendes Auktionssystem, das dort weit verbreitet ist. Dabei ist der Bieter persönlich nicht anwesend, sondern gibt bis zu einem festgelegten Zeitpunkt sein Höchstgebot schriftlich (auch telefonisch) ab. Die Auktion findet praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Damit ist das unter dem Zuschlag liegende Gebot nicht zweifelsfr...
Maille
1. Französische Bezeichnung für das Halbstück des mittelalterlichen Pfennigs, der in Frankreich - ebenso wie in Deutschland und Italien - selten ausgeprägt wurde. Die Halbstücke wurden lat. alsObolus, ital. als Maglia und deutsch als Hälbling oder Scherf bezeichnet. Die Benennung Maille ist vermutlich aus dem für die Obole von Melle verwendeten Ausdruck "metala" abgeleitet. 2. Oft werden auch kleine, mittelalterliche Silberpfennige aus Flandern als Mailles bezeichnet; eine missverst
Mainaden
Auch Bacchantinnen, sind die jungen Mädchen aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos (Bacchus). Sie kommen seit dem 4. Jh. v. Chr. mit Weinlaub oder Efeu bekränzt auf Münzen von Makedonien, Lampsakos, Kydonia und Histaia vor. Einzelne Mainaden erscheinen auf Münzen von Abdera, Ankyra, Syrakus und Sikyon, meist im Tanzschritt dargestellt. Die Mainade erscheint auf römischen Kontorniaten mit Thyrsos, Weinstock oder das Tympanon schlagend. Regling berichtet von nordgriechischen Münzen, die ein...
Maiorina
Kaiser Constans (333-350 v. Chr.), der jüngste Sohn Konstantin des Großen, führte im Rahmen der Münzreform von 346 v. Chr. eine neue Bronzemünze ein, die den Follis zunächst ersetzte. Die Münze war nur noch schwach mit Silber legiert, schwankte im Gewicht zwischen 3,5 und 7,5 g und hatte einen Durchmesser von 20 bis 24 mm. Die Maiorina wird in der numismatischen Literatur auch oft mit AE und Angabe des Durchmessers, manchmal auch als doppelte Centenionalis bezeichnet. Die Benennung der M
Majuskel
Bezeichnung für Großbuchstaben im Gegensatz zu Minuskel (Kleinbuchstaben). Bei der Münzbeschriftung wurden fast ausschließlich Majuskeln benutzt wird. Die Minuskel fand auf Münzen selten Verwendung, etwas häufiger auf Medaillen oder beim Chronogramm.
Makkabäermünzen
Bezeichnung der antike Münzen Israels (Judäa), die etwa zwischen 135 v. Chr. bis 135 n. Chr. geprägt wurden. Die Dynastie der Makkabäer oder Hasmonäer, regierte eigentlich nur bis 37 v. Chr., aber auch die Münzen des ersten Aufstands gegen die Römer (66-70 n. Chr.) und des 2. Aufstands oder Bar-Kochba-Krieges (132-135 v. Chr.) werden zu den Makkabäermünzen gezählt. Unter den Hasmonäern wurde die bronzene Pruta oder Prutah ausgegeben, der erste Aufstand brachte zudem die Prägung silbe...
Mala conservación
Abgekürzt M.C., spanischer Ausdruck für den Erhaltungsgrad „gering erhalten“, der als nicht mehr sammelwürdig betrachtet wird.
Maler, Christian
Maler, Valentin
Bedeutende Nürnberger Medailleure (Vater und Sohn), die im späten 16. und frühen 17. Jh. Medaillen und Münzstempel schnitten. Valentin erhielt das kaiserliche Privileg, Medaillen zu fertigen, das auf vielen Stücken mit der lat. Inschrift C(um) PRIV(ilegio) C(aesaris), mit dem Privileg des Cäsaren, verbürgt ist. Beide waren an den Münzstätten Nürnberg und Würzburg beschäftigt und schnitten dort eine Reihe von Stempeln für Münzen. Christian entwarf und schnitt auch St...
Maleygroschen
Kleine böhmische Groschenmünze, die zwischen 1576 und 1618 in großen Mengen umlief. Die Billonmünze wog ca. 1,05 g (390/1000 fein) und stand im Verhältnis 6:7 zum Kreuzer. Der Standardtyp zeigt auf der Vs. den (böhmischen) Löwen, auf der Rs. die gekrönten kaiserlichen Initialen über der Wertbezeichnung. Der Ausdruck leitet sich von der Aufschrift "Maley" (tschechisch: maly grosz = kleiner Groschen) her, das als erstes tschechisches Wort auf Münz...
Malkontentenmünzen
Bezeichnung für die Prägungen der ungarischen Malkontenten, die unzufrieden (frz.: mal content ) mit der Herrschaft der österreichischen Habsburger waren. Fürst Ferenc II. Rákóczi proklamierte 1703 die Unabhängigkeit Ungarns, stellte sich an die Spitze Siebenbürgens und der ungarischen Stände und führte den bewaffneten Aufstand gegen Wien an, der 1711 endgültig niedergeschlagen wurde. Die Aufständischen prägten zwischen 1704 und 1707 den Dukaten, den berühmten silbernen Gulden im G...
Maloti
Plural (Mehrzahl) der Währungseinheit von Lesotho, Singular (Einzahl) Loti. Seit 1966 gilt: 1 Loti = 100 Lisente.
Mameita-Gin
Rundliche beprägte Silberklümpchen, die vom 16. Jh. bis in die zweite Hälfte des 19. Jh.s im feudalen Japan als Zahlungsmittel diente, hierzulande auch als „Bohnensilber“ bezeichnet. Sie sind beidseitig mit Stempeln versehen, darunter immer das Zeichen für den Gott des Reichtums (Daikoku). Andere Zeichen beziehen sich auf die Ära und können wichtige Aufschlüsse über die Datierung der Stücke enthalten.
Bis zur Rückgabe der Regierungsgewalt an den Kaiser (Tenno) 1867, waren die gegos...
Man-Nen-Tsu-Ho
Alter japanischer Münztyp, der zur Regierungszeit des Kaisers Junnin vom 4. bis zum 9. Jahr der Epoche Tempej-Hojo (760-765 v. Chr.) ausgegeben wurde. Der Man-Nen-Tsu-Ho, was etwa "umlaufender Schatz der zehntausend Jahre" bedeutet, gilt - nach dem Wa-Do-Kai-Ho - als zweitältester Münztyp, der je in Japan hergestellt wurde. Neben Bronzemünzen sollen auch wenige Silber- und Goldmünzen zur Ausgabe gelangt sein.
Mancus
Bezeichnung für den arabischen Dinar im christlichen Abendland zwischen dem ausgehenden 8. und dem 13. Jh. Im weiteren Sinn auch eine Rechnungsmünze und ein Gewicht, das diesem Wert entsprach. Die Benennung geht wohl auf das arabische zurück, ein Ausdruck für die seit der Münzreform von Abd al-Malik (696-698) geprägten Gold- und Silberdinare. Der Name wird zuerst in Dokumenten aus dem Kloster Sesto in Friaul 778 genannt, dann auch in Treviso (793). In den "Chansons de Geste" über die Kreu...
Mandat Territorial
Französisches Papiergeld, das während der Revolution die Assignaten ablöste. Das Papiergeld wurde 1796 als Promesses des Mandats Territoriaux zu 25, 100, 250 und 500 Francs als Anweisungen auf Mandats und selten als Mandats Territoriaux zu 5 Francs ausgegeben. Der Inhaber der Mandats sollte das Recht erhalten, beschlagnahmtes Grundeigentum der Kirche und des Adels zum Taxwert gegen diese Scheine im gleichen Nominalwert zu übernehmen. Aber ebenso wie bei Assignaten sank der W...
Mandorla
Ital. Bezeichnung für Mandel, eine mandelförmige spitz-ovale Form, die ähnlich dem Heiligenschein in der christlichen Mystik als Symbol für die Unbeflecktheit steht. Daher findet sich auf Münzbildern meist Maria (z.B. die Madonna auf ungarischen Münzen) oder Christus in der Mandorla (z.B. auf Zechinen aus Venedig). Seit dem Mittelalter war die Mandorla auch eine gebräuchliche Form für Siegel.
Darstellung Christi in Mandorla auf dem Revers ein Zecchinovon Venedig
Mangir
Bezeichnung der türkischen Kupfermünze etwa von der Mitte des 14. Jh.s bis zum Beginn des 18. Jh.s. Die unregelmäßigen Kupferprägungen der Osmanen sind in schwankenden Gewichten geschlagen worden. Auch ihr Wertverhältnis zu dem kleinen silbernen Akce war großen Schwankungen unterworfen, je nach Zeit und Gewicht. Die Kupferstücke sind meist krude, nicht ganz rund geformt.
Mangul
Bezeichnung von kleinen Salzbarren, die im Königreich Bornu im heutigen Nordnigeria als Zahlungsmittel dienten. Sie wurden aus großen Salzbarren hergestellt, die zur Trockenzeit importiert worden waren. In eigens dafür hergestellten kleinen Tontöpfen löste man Salzstückchen auf, die nach erneuter Kristallisierung zerschlagen wurden. Bei den Haussa sollen die Mangul ein unverzichtbarer Bestandteil des Brautpreises gewesen sein. Außerdem dienten die Salzbarren ...
Manilla
Auch Manilha oder Manilly, sind europäische Bezeichnungen für ein vormünzliches Zahlungsmittel aus Kupfer oder Messing, das in Form von hufeisenförmig gebogenen Dreiviertelringen mit verdickten, schnabelförmigen oder abgeplatteten Enden am Golf von Guinea und dem Hinterland als wichtiges Zahlungsmittel kursierte. Das Verbreitungsgebiet der Manillen reichte von Guinea bis in Teile Kameruns; je nach Gebiet hatten sie verschiedene afrikanische Namen und formale Abweichungen. Das Hauptverbreitu...
Mansfelder Ausbeutetaler
Bezeichnung für die Talermünzen, die der König von Preußen zwischen 1826 und 1862 aus der Ausbeute der Silberbergwerke der an Preußen gefallenen ehemaligen Grafschaft Mansfeld prägen ließ (Ausbeutetaler). Ihre Vs.n zeigen das Porträt des preußischen Königs, die Rs.n die Schrift SEGEN DES MANSFELDER BERGBAUES im Zentrum. Zwischen 1826 und 1856 ließ der preußische König regelmäßig jährlich 50.000 Stücke im Graumannschen Münzfuß (14-Talerfuß) herausgeben. Die Umschrift lautet E...
Mansois
Bezeichnung des mittelalterlichen Deniers (Denar) der Grafschaft Maine, die heute im Wesentlichen die Départements Mayenne und Sarthe (Hauptstadt Le Mans) umfasst. Die Grafschaft Maine war Lehensgebiet der französischen Krone und stand im frühen Mittelalter zuerst unter dem Einfluss der benachbarten Normannen im Nordwesten und seit dem 12. Jh. der Grafen von Anjou (Haus Plantagenet) im benachbarten Süden. Die Deniers der Grafschaft zählen zu den Feudalmünzen Frankreichs, die durch den Mach...
Mantelet d'or
Beiname des unter dem französischen König Philipp IV., dem Schönen (1285-1314), zwischen 1305 und 1308 ausgegebenen Petit Royal d'or. Der Name entstand nach dem Münzbild auf der Vs., das den sitzenden König im Mantel zeigt, in den Händen Zepter und Fleur de lis. Die Rs. der Goldmünze zeigt das Blumenkreuz mit vier Fleur de lis in den Winkeln.
Maple Leaf
1. Bezeichnung der kanadischen Gold-, Silber- und Platinbarrenmünzen, die in 5-, 10-, 20- und 50-Dollar-Stücken ausgegeben werden. Die Vs. zeigt Königin Elisabeth II., die Rs. das kanadische Ahornblatt (engl.: maple leaf) und Angaben zu Feingewicht und/oder Feingehalt.2. Bezeichnung seltener kanadischer Währungsmünzen von 1 Cent bis zu 1 Dollar, die bis zur Fertigstellung der neuen Prägestempel im Jahr 1948 mit dem (alten) Prägestempel von 1947 und einem kleinen Ahornblatt hinter der Jahr...
Maravedi
1. Auch Marabinito oder Morabinito, sind ursprünglich Bezeichnungen für Nachahmungen der arabisch-spanischen Goldmünzen durch christliche Herrscher in Spanien und Portugal im 12./13. Jh. v. Chr. Als Vorlage dienten die Goldmünzen der Almoraviden (bis 1147) bzw. der nachfolgenden Almohaden. Die ersten portugiesischen Marabiniti wurden in Coimbra geschlagen. Sie zeigen den Herrscher auf dem Pferd und die Quinas (kreuzförmiger Landesschild) mit vier Sternen in den Winkeln. Sie wurden mögliche...
Marcello
Bezeichnung der halben Lira aus Venedig, die nach dem Dogen Nicolo Marcello (1473/4) benannt ist, der sie im Wert von 10 Soldi einführte. Sie zeigt auf der Vs. den vor dem hl. Markus knienden Dogen, auf der Rs. Christus. Der Wert der etwa 3,25 g schweren Silberstücke (948/1000 fein) wurde im 16. Jh. auf 12 Soldi erhöht und bis in die Mitte des 16. Jh.s geprägt. In zeitgenössischen deutschsprachigen Dokumenten auch Marcelle genannt.
Marengo
Marengo, im Plural Marenghi, bezeichnete umgangssprachlich ein goldenes 20-Franc-Stück, das von der Subalpinischen Republik, einem kurzlebigen, von Frankreich abhängigen Staat in Piemont, in den Jahren 1800 und 1801 geprägt wurde. Die Bezeichnung der goldenen Gedenkmünze entstand in Anerkennung der Schlacht bei Marengo bei Turin, in der Napoleon Bonaparte die Habsburgermonarchie besiegte.
Die Münze folgte dem französischen Münzgesetz, wonach aus 1000 Gramm Gold 155 Stücke geprägt wurden...
Margarethengroschen
Bezeichnung von Groschenmünzen, die neben dem Namen des Kurfürsten Friedrich II. auch dessen Gemahlin Margarethe nennen. Es handelt sich um die seit 1440 geprägten meißnischen Schildgroschen, die teilweise auch noch den Namen Wilhelm III. aufweisen.
Maria-Theresien-Taler
Bezeichnung des nach dem Konventionsfuß geprägten österreichischen Talers, der auf der Vs. die Büste der Kaiserin Maria Theresia (1740-1780) trägt. Im Besonderen ist damit ein Typ gemeint, der als Handelsmünze des 18. und 19. Jh.s in Afrika und im Orient (Levantetaler) eine herausragende Bedeutung gewann. Er stammte aus der Münzstätte Günzburg, einer vorderösterreichischen Enklave (Markgrafschaft Burgau) im heutigen Bayern und war auch in späteren Jahren immer mit der Jahresangabe 178...
Marianne
Allegorie der Republik Frankreich. Sie ist nicht identisch mit der weiblichen Symbolfigur der Freiheit, die nach der Französischen Revolution auf vielen republikanischen Franc- und Centime-Münzen dargestellt ist. "Marianne" war die Bezeichnung einer revolutionären Geheimgesellschaft im Frankreich der Restauration und des Bürgerkönigtums und die weibliche Symbolfigur der revolutionären Freiheit in Frankreich. Später entwickelte sich die "Marianne" schließlich zum Symbol für das republika...
Mariengroschen
Niedersächsische Groschenmünze vom 16. bis zum 19. Jh., deren Name sich von der Darstellung der Mutter Gottes mit Kind auf dem ursprünglichen Münzbild ableitet. Kennzeichnend für Niedersachsen waren die seit dem Spätmittelalter relativ mächtigen, unabhängigen Städte, die neben den Fürsten der Welfen-Dynastie das Münzwesen der Region bestimmten. Abgesehen von der Nachahmung der Meißner Groschen durch die Welfen begann die Groschenprägung in Niedersachsen erst spät. Im 15. Jh. entsta...
Mariengulden
Vorwiegend Rechnungsmünze, als Zweidritteltaler gelegentlich auch ausgeprägt, z.B. von Herzog Friedrich Ulrich (1613-1634) von Braunschweig-Wolfenbüttel in den Jahren 1623/24, auch als Halbstück (Dritteltaler). Der Mariengulden zeigt auf der Vs. das Monogramm des Fürsten, auf der Rs. die Wertbezeichnung.
Marienmünzen
Bezeichnung für Münzen mit dem Bild der hl. Maria. Die ersten Darstellungen der christlichen Heiligen erschienen auf Byzantinischen Münzen seit Kaiser Leo VI. (886-912). Auf karolingischen Münzen von Reims und Puy kommen Mariensymbole wie Stern, Rose oder Lilie vor. Seit Mitte des 11. Jh.s finden sich die ersten Mariendarstellungen auf niederländischen (Maastricht, Verdun) und deutschen Denaren (Augsburg, Hildesheim, Speyer), im 12. Jh. auf Brakteaten aus Magdeburg. Die Mariendarstellungen ...
Mark Banco
Die Mark Banco: Hamburgs historische Rechenwährung
Die Mark Banco, eine bedeutende Rechenwährung des 17. bis 19. Jahrhunderts, spielte eine zentrale Rolle im Handels- und Finanzwesen Hamburgs. Als Symbol für die Solidität des Hamburger Kaufmanns prägte sie den Wirtschaftsstandort Hamburg nachhaltig und beeinflusste den internationalen Handel weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus.
Entstehung und Funktion der Mark Banco
Die Geburtsstunde der Mark Banco schlug im Jahr 1619 mit der Grün...
Mark I
1. Ursprüngliche Gewichtseinheit, Recheneinheit (Zählmark) und Bezeichnung für verschiedene Münzen und Währungen (siehe Mark II). Der Ursprung des Wortes kommt wohl aus dem Altnordischen, ein Zusammenhang mit „markieren“ (zeichnen) wird angenommen. Im 11./12. Jh. löste die Mark in Europa allmählich das karolingische Karlspfund als Münzgrundgewicht ab. Die Wägepraxis auf ungleicharmigen Schnellwagen lassen darauf schließen, dass die Mark (Marca) die Hälfte eines (nordischen) Pfunde...
Mark II
Die Mark als Münzbezeichnung wurde in der frühen Neuzeit vor allem im norddeutschen und nordeuropäischen Raum verwendet:1. Im Jahr 1501 beschlossen die Städte des Wendischen Münzvereins mit der Ausprägung ihrer bisherigen Zählmark zu 16 Schillingen einen eigenen Weg zu beschreiten. Die Zwei- und Eindrittelstücke der Lübischen Mark wurden aber nur kurzfristig von den Städten Lübeck und Lüneburg ausgemünzt. Bereits 1504 vereinbarten die Städte des Wendischen Münzvereins, die Lübeck...
Marken
Numismatische Objekte oder Münzersatzmittel, die zu verschiedenen Zwecken - meist wie Münzen - aus Metall, aber auch aus anderen Materialien (Bein, Holz, Glas, Pappe, Papier) hergestellt wurden. Die münzähnlichen Gebilde dienten schon im Altertum als Berechtigung zum Bezug von Waren (Getreide, Öl) und Geld, als Eintrittskarten für Volksversammlungen, Theatervorstellungen und Bordelle (Spintriae). Die Marken aus der griechischen Überlieferung sind als Symbola bekannt, die des Römischen Re...
Markgraf
Lat. Marchio, Marchisus, bezeichnete im Frankenreich den Stellvertreter des Königs im militärisch gesicherten Vorfeld der Stammesherzogtümer (Marken), der mit besonderen Befugnissen ausgestattet war. Die dem Reichsgebiet vorgelagerten Marken spielten eine wichtige Rolle als militärisches Aufmarschgebiet zu Kriegszeiten, im Osten auch zur Christianisierung der Bevölkerung angrenzender Stämme. Die Vollmachten der Markgrafen (Heerbann, hohe Gerichtsbarkeit, Befestigung...
Markka
Bezeichnung der finnischen Währungseinheit. 1 Markka = 100 Pennia. Die Markka (Mehrzahl: Markkaa) wurde 1860 im damals unter russischem Einfluss stehenden Großherzogtum Finnland als 1/4-Rubel eingeführt. Die Bezeichnung geht auf die Mark( Mark II) zurück, eine im Ostseeraum seit dem 16. Jh. gebräuchliche Münze in Skandinavien und Norddeutschland.
Markuslöwe
Wappen und Wahrzeichen Venedigs, Symbol und Attribut des hl. Markus in Gestalt eines geflügelten Löwen. Der Legende nach ließ der Doge von Venedig im 9. Jh. die Gebeine des Evangelisten Markus von Alexandria nach Venedig überführen. Seitdem finden sich die Darstellungen des Stadtpatrons und/oder des geflügelten Löwen auf vielen Münzen Venedigs bzw. der Republik San Marco. Die heraldische Darstellung zeigt den geflügelten Löwen meist mit Heiligen...
Mars
Italischer und römischer Gott des (gerechten) Kriegs, in Entsprechung zum griechischen Ares. Nach ihm ist der Monat März genannt. Auf Münzen der römischen Republik war häufig der Kopf des Kriegsgottes dargestellt ( Mars-Adler-Gold). Auf Münzen der Kaiserzeit erscheint Mars meist als stehende Ganzfigur mit Helm und den Attributen Speer und Legionszeichen.
Darstellung des Mars auf einem As des Marcus Aurelius
Mars-Adler-Gold
Seltene Goldstücke der Römischen Republik, die während des 2. Punischen Kriegs nur in den Jahren 211/210 v. Chr. in Werten zu 60, 40 und 20 Asses geprägt wurden. Die Vs. der Goldmünze zeigt den behelmten Kopf des Kriegsgottes Mars, die Rs. den Adler auf Donnerkeilen.
Martí
Zeitgenössische volkstümliche Bezeichnung der kubanischen Goldmünzen in den Werten 1, 2, 4, 5 10 und 20 Pesos, die 1915/16 zum Gedenken an den Tod von José Martí (1853-1895), Schriftsteller, Journalist und Führer des Aufstands gegen Spanien, geprägt wurden. Die Stücke zeigen das Kopfbild des Freiheitskämpfers über der Jahreszahl mit der Umschrift PATRIA Y LIBERTAD. Die Rs. zeigt das Wappen der Republik Kuba im Halbkranz, darunter die Wertbeze...
Massachusetts-Half
Massachusetts-Cent
Die Generalversammlung des Staates Massachusetts, einer der 13 jungen Staaten der Vereinigten Staaten von Nordamerika, beschloss am 17. Oktober 1786 ein Gesetz zur "Errichtung einer Münze zur Prägung von Gold, Silber und Kupfer". Es kam allerdings nur zur Prägung von Kupfermünzen in zwei Größen. Sie zeigen auf der Vs. einen Indianer, stehend mit Pfeil und Bogen in den Händen, umschriftlich COMMON WEALTH. Die Rs. zeigt einen Adler mit Pfeilbündel und Palme in den Klauen...
Massachusettsgeld
Sammelbezeichnung für die ersten von Massachusetts eigenständig geprägten Münzen der englischen Kolonien Nordamerikas. Dazu zählen die New England- und die typverwandten Oak Tree-, Pine-Tree- und Willow Tree-Münzen. Ihnen allen gemeinsam ist die Angabe der Wertzahl, des Jahres (1652) und der Wertstufen XII (12), VI (6) und III (3) in Pence (Ausnahmen und Besonderheiten siehe unter den einzelnen Stichpunkten).
Die Siedler an der Ostküste waren im 17. Jh. mit Münzgeld erheblich unterversor...
Masse d'or
Französische Goldmünze, die Philipp III. (1270-1285) im Gewicht von etwa 4,75 g aus fast reinem Gold einführte. Zur Unterscheidung der von seinem Nachfolger Philipp IV. geprägten schwereren und größeren Masse d'or wird die Goldmünze Petite masse d'or genannt. Die unter Philipp IV. (1285-1314) ausgegebene Masse d'or im Raugewicht von 6,93 g war aber nur etwa 920/1000 fein. Die Goldmünzen sind nach der Vorderseitendarstellung eines Zepters benannt (lat. reg...
Masson
Lothringische Billonmünze aus dem 18. Jh. im Wert von 12 Sols 6 Deniers, die nach Masson, dem damaligen Münzdirektor im Herzogtum Lothringen, benannt ist.
Herzog Leopold I. (1697-1729), Masson 1728
Matapan
Venezianischer Grosso, den der Doge Enrico Dandolo (1192-1205) um 1202 in Venedig einführte. Das Münzbild zeigt auf der Vs. den hl. Markus, der dem Dogen die Herzogsfahne überreicht, auf der Rs. den thronenden Christus mit den Initialen IC und XC im Feld. Der Wert des Grosso überstieg wahrscheinlich 12 Denari. Bei einem Gewicht von annähernd 2,2 g enthielt er einen erstaunlich hohen Silberanteil (965/1000). Das Vielfachstück des venezianischen Denaro regte wohl auch andere Städte Oberita...
Materialwert
Unter dem Materialwert versteht man den Wert des Materials, das zur Herstellung des Geldes verwendet wird. In den Zeiten der Edelmetallwährungen ist er praktisch mit dem Metallwert gleichgesetzt und drückt den inneren Wert der Gold-, Silber- oder Kupfermünzen aus. Der Begriff Materialwert ist etwas weiter gefasst als der Metallwert, denn er gilt beispielsweise auch für Münzen aus Porzellan oder für Papiergeld.
Wovon hängt der Materialwert eines Zahlungsmittels ab?
Der Materialwert einer M...
Matona
Bezeichnung der äthiopischen Kleinmünze, die nach der Kaiserkrönung Haile Selassies 1930 v. Chr. (nach äthiopischer Zeitrechnung 1923) ausgegeben wurde und seit der Einführung des Dezimalsystems von 1933 bis 1945 als Unterteilung des Birr (Talers) fungierte: 100 Matonas = 1 Birr. Es gab 1- und 5-Matonas-Stücke in Kupfer und 10-, 25- und 50-Matonas-Stücke in Nickel. Die Matonas wurden 1945 vom Santeem (Cent) abgelöst.
Matrize
Die negative Matrize wird aus der positiven Patrize im Senkverfahren hergestellt. Siehe auch Stempel und Münztechnik.
Mattengeld
Aus Pflanzenfasern hergestellte Matten, die - je nach Region - verschiedene Geldfunktionen übernahmen. Als eine der wenigen Geldarten Polynesiens gelten die kunstvoll gearbeiteten Matten der Samoaner, die mit roten Federn verziert waren. Sie galten als Wert- und Tauschobjekte, in reichen Familien wurden sie als Mitgift bei Eheschließungen verwendet. Ihre wichtigste Verwendung bestand jedoch darin, die Kanu- und Hausbauer zu entlohnen. In Melanesien ist Mattengeld von den Santa-Cruz-Inseln...
Matthiasgroschen
Im weiteren Sinn Bezeichnung für alle Groschenmünzen, die das Bild des Apostels Matthias aufweisen. Zu Beginn des 15. Jh.s waren die Pfennigmünzen im Silbergehalt und im Wert so weit abgesunken, dass sich die Stadt Goslar und das Bistum Hildesheim entschlossen, dem Beispiel anderer Münzstände zu folgen und ihrerseits Groschen auszuprägen. Sie einigten sich im Jahr 1410 auf die Prägung eines Gemeinschaftsgroschens, der auf der Vs. den Schild des Stiftes und das ...
Matzenkopf
Stempelschneider- und Medailleur-Familie, deren Mitglieder bis zur Abtretung des Fürstentums Salzburg an Österreich 1805 an der Münze in Salzburg tätig waren. Franz Matzenkopf der Ältere schuf etwa zwischen 1727 und 1754 nicht nur schöne Münzstempel für die Erzbischöfe von Salzburg sondern fertigte auch hervorragende Medaillen. Sein Sohn Franz der Jüngere führte die Tätigkeiten des Vaters seit 1755 fort, seit 1789 unterstützt von s...
Mauerkrone
Eine Krone, deren Gestalt an eine Burgmauer erinnert. Oft mit Ziegelmustern, kleinen Türen und Fenstern und oben mit kleinen Türmen und Zinnen versehen. Diese Art der Krone wurde schon in der Antike im griechischen Kulturkreis ausschließlich von weiblichen Figuren getragen. Man findet sie auf den Köpfen von Aphrodite (auf Münzen in Paphos und Salamis), der Kybele und Tyche verschiedener Städte und Länder (z.B. im bithynischen Herakleia) sowie verschiedener Stadtgöttinnen (Nymphen und Ama...
Maundy Money
Satz von vier kleinen Silbermünzen zu 1 Penny, 2, 3 und 4 Pence, die von Großbritannien alljährlich geprägt werden. Sie werden traditionell am Gründonnerstag (Maundy Thursday) vom regierenden englischen Monarchen oder einem Repräsentanten an arme, ältere Männer und Frauen verteilt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Zusätzlich werden etwa 1000 Sätze an Würdenträger verteilt, die sich an der Zeremonie beteiligen, früher wurden sie auch Sammlern zum Kauf angeboten.Der ...
Max d'or
Goldmünze, die Kurfürst von Bayern Maximilian Emanuel (1679-1726) seit 1715 als doppelten bayerischen Goldgulden prägen ließ. Die Max d'ors waren aber weniger wert als zwei Goldgulden und wurden folglich auf dem Reichsmünztag von Regensburg 1737 um 4 Kreuzer niedriger bewertet als der doppelte Goldgulden. Die Goldmünze zeigt auf der Vs. die Büste des Kurfürsten, auf der Rs. die Madonna mit Kind. Sie wurden von dem Karolin seines Nachfolgers Karl Albert (1726-1744) abgelöst.
...
Mazuna
Algerische und marokkanische Kleinmünze, die bis 1837 im Namen des türkischen Sultans ausgegeben wurde. Für das unabhängige Algerien wurden zuletzt 3-Mazunas-Stücke ausgegeben, deren Prägung mit der Gefangennahme des Berberfürsten Abd el-Kader durch die Franzosen 1848 endgültig erlosch. 24 Mazunas galten einen Budju. In Marokko wurden 1922 zuletzt 10-Mazunas-Stücke aus Bronze hergestellt, 50 Mazunas galten einen Dirham.
Medaille
Bezeichnung für münzähnliche Erinnerungsstücke, die im Gegensatz zur Münze keinen Geldcharakter haben. Das Wort stammt ursprünglich vom lat. „metallum“ (ital. medaglia) und wurde über die französische Bezeichnung „médaille“ in die deutsche Sprache übernommen. Die antiken Vorläufer der Medaillen sind die Medaillons und Kontorniaten aus der römischen Kaiserzeit, die Schau- und Erinnerungsstücke waren, auch wenn sie teilweise anderen Zwecken dienten. Auch zur Zeit der germanisc...
Medailles de confiance
Bezeichnung für das von Privatfirmen während der französischen Revolution in den Jahren 1791/92 ausgegebene Kleingeld. Diese Bezeichnung könnte zu der irrigen Annahme führen, es handele sich um Medaillen ohne Geldcharakter. Da es sich um Zahlungsmittel handelte, ist die Bezeichnung Monnaies de confiance vorzuziehen.
Medailleur
Bezeichnung für den Schöpfer von Münzen und Medaillen. Der Medailleur gestaltet das Modell, das vom Stempelschneider oder Graveur auf den Stempel übertragen wird. Im Fall von Gussmedaillen modelliert der Medailleur die Gussformen. Die Namen der Medailleure sind in der Regel erst seit der Renaissance überliefert.
Medaillon
1. In der Numismatik Bezeichnung für antike, großformatige Schau- oder Gedenkstücke aus Bronze oder Edelmetall. Die meisten antiken Medaillons stammen aus den offiziellen Münzstätten der römischen Kaiserzeit, nur wenige aus der hellenistischen Epoche. Sie zeigen auf der Vs. die Büste des Kaisers und preisen auf der Rs. die Tugenden der Kaiser oder verweisen auf historische Ereignisse. Wegen ihrer besonderen Größe und ihrer sorgfältigen künstlerischen Gestaltung werden sie von den Mün...
Medici
Einflussreiche Florentiner Kaufmanns- und Bankiersfamilie (ältere Linie) und Fürsten (jüngere Linie), die sich auch als Mäzene der Kunst einen Namen machte. Nachdem Giovanni di Bicci (1360-1429) durch Finanzgeschäfte mit dem Papst den Grundstock für den Reichtum der Medici gelegt hatte, konnte sein Sohn Cosimo (il Vecchio, 1389-1464) erfolgreich als Unternehmer wie auch als Politiker (Verbindung mit Mailand, Lega italica) agieren. Er war in der Lage, große Beträge aus dem Unternehmen zu ...
Medicina in Nummis
Umfangreiches Sammelgebiet von Münzen und Medaillen, die sich auf medizinische Themen beziehen. Bereits seit dem 19. Jh. werden Motive aus diesem Gebiet gesammelt. Schon in Antike gab es Gepräge mit Darstellungen der Götter der Heilkunst (Asklepios, Hygieia, Salus), Ärzten (Hippokrates, Xenophon), Heilpflanzen (Mohn) und Heiltieren (Zitterrochen) sowie zur Hygiene und zum Badewesen. In der Neuzeit machen allerdings nicht Münzen, sondern Medaillen den überwiegenden Teil des Sammelgebietes a...
Medina del Campo
Spanischer Ort in Kastilien, an dem die neue spanische Münzordnung vom 3. Juni 1497 verkündet wurde, die als Pragmatische Sanktion (Pragmatica) von Medina del Campo in die Geschichte einging. Sie bildete den Abschluss der schon seit 1475 anhaltenden Reformbemühungen um die Neuordnung der Münzverhältnisse Spaniens. Das Edikt stattete das Königreich Spanien unter dem Herrscherpaar Ferdinand von Aragon (1479-1516) und Isabella von Kastilien und Leon (1474-1504) zugleich mit dem fortschrittlic...
Medino
Auch Meidin, war die Bezeichnung des Para, der unter der Herrschaft der Osmanen in Ägypten umlief.
Medusa
Mythologisches Ungeheuer des Altertums, das zusammen mit seinen beiden Schwestern die Gorgonen bildet. Der Blick der hässlichen, geflügelten, mit Schlangen behaarten Medusa ließ jedes menschliche Wesen zu Stein erstarren. Der Sage nach gebiert sie bei ihrem Tod (durch den Helden Perseus) Chryasor und Pegasos. Perseus übergibt das Haupt der Medusa der Göttin Athene, die es in ihrem Schild trägt, um Feinde mit dem „bösen Blick” abzuwehren. Auf antiken griechischen Münzen ist das Kopfbi...
Mehlmarken
Münzförmige Zeichen, die zur Abrechnung von Mehl für geliefertes Getreide ausgegeben wurden, auch Mühlenmarken genannt. Die städtischen Mühlen gaben, je nach Getreidesorte und eingelieferter Menge, Marken in verschiedenen Metallen und Legierungen aus, die gegen Mehl eingetauscht werden konnten. Einige Städte gaben auch an Bedienstete, Soldaten und Bedürftige Marken aus, die zum Erhalt einer festgelegten Menge Mehl berechtigten.
Meißner Groschen
Als Meißner Groschen werden sächsisch-thüringische Groschenmünzen bezeichnet, die um 1338 nach dem Vorbild der Prager Groschen eingeführt wurden. Geprägt wurden die Silbermünzen von Friedrich II. aus dem Geschlecht der Wettiner, Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen, in der Landeshauptmünzstätte Freiberg. In den ersten 100 Jahren ließ man den Meißner Groschen ausschließlich in Freiberg schlagen.
Prägemotiv der Münze
Der in Freiberg geprägte Meißner Groschen zeigt auf d...
Melgorien
Bezeichnung des mittelalterlichen Deniers aus der Münzstätte Melgueil (im Departement Bouches du Rhône). Die Melgorienses waren zwischen dem 11. und 13. Jh. in Südfrankreich weit verbreitet. Sie zählen zu den Feudalmünzen Frankreichs, die sich bei schwacher Zentralmacht im 11. Jh. verschlechterten. Dadurch bildete sich das für den Geldverkehr nützliche Wertverhältnis 1:2 zu den Deniers aus der Münzstätte Toulouse (Toulousains) aus. Damit st...
Melikertes
Auch Palaimon, ist eine griechische Meeresgottheit der Antike. Der Sohn von Athamos und Ino floh vor seinem Vater ins Meer und kommt auf korinthischen Bronzemünzen als Knabe im Arm seiner Mutter, auf dem Altar oder zusammen mit Delfinen vor.
Melioli, Bartolomes
Italienischer Goldschmied, Stempelschneider und Medailleur aus Mantua. Melioli, der in Diensten von Francesco II. Gonzaga (1484-1519) von Mantua stand, gilt als Stempelschneider für einige der schönsten Münzen der Renaissance. Nur wenige Medaillen sind von ihm bekannt, die meisten zeigen Porträts von Mitgliedern der Adelsfamilie Gonzaga.
Melkart
Phönizischer Gott, Stadtgott von Tyros, erscheint auf Münzen der phönizischen See- und Handelsstadt im 4./5. Jh. v. Chr. auf einem Hippokamp sitzend, mit Pfeil und Bogen. Später wird er mit Herakles identifiziert.
Men
Lunus
Phrygischer Mondgott, Stadtgott von Antiochia/Pisidien, Gott der (Wege zur) Unterwelt und Fruchtbarkeit, ist meist auf kleinasiatischen Kolonialprägungen zur römischen Kaiserzeit dargestellt. Sein Erkennungszeichen ist die phrygische Mütze. Auf Münzen erscheint seine Büste, das Kopfbild oder seine gesamte Gestalt (stehend) mit den Attributen Mondsichel, Schale, Pinienzapfen und Zepter. Einige Darstellungen zeigen ihn mit Nike, Pferd, Stierschädel unter dem linken Fuß und mit einem H...
Menadier, Julius
Numismatiker, seit 1889 Mitherausgeber der "Zeitschrift für Numismatik" (Berlin, 1874-1935), seit 1891 Direktor des Berliner Münzkabinetts (bis 1921) und 1896 zum Professor ernannt. Der Numismatiker erwarb sich vor allem Verdienste um die Erforschung des deutschen mittelalterlichen Münzwesens. Unter dem Titel "Deutsche Münzen" ( 4 Bde. Berlin 1874-1935) sind gesammelte Aufsätze zur Geschichte des deutschen Münzwesens veröffentlicht.
Menger, Johan Philip
Niederländischer Medailleur und von 1853 bis 1891 erster Münzgraveur an der königlich-niederländischen Reichsmünze Utrecht (Münzzeichen: Merkurstab). In Diensten des Königs Wilhelm III. (1849-1890) gravierte er die Stempel für eine Reihe niederländischer Münzen. Daneben schuf er eine große Anzahl von Porträt-, Ereignis- und Preismedaillen. Sein Sohn Johan Philip Mathias übernahm die Stellung als erster Münzgraveur in Utrecht ...
Menudo
Kleine katalanische Billonmünze aus der Münzstätte Barcelona. Unter Philipp III. (1598-1621) wurde die Münze eingeführt. Sie zeigt auf der Vs. den Kopf des Königs, auf der Rs. ein Kreuz und den Münzbuchstaben B. Während der Besatzung Barcelonas durch den französischen König Ludwig XIII. (1641-1652) wurden kupferne Menudos ausgegeben.
Meranierpfennige
Zweiseitig beprägte Pfennige aus Ostfranken, die zwischen 1150 und 1250 im Umlauf waren. Sie wurden unter der Herrschaft des Fürstengeschlechts der Andechs-Meranier geschlagen. Dieses Fürstengeschlecht stellte ein Jh. lang sowohl die weltlichen Herren der späteren hohenzollerschen Lande wie auch fast durchgängig die Fürstbischöfe des Bistums Bamberg. Die weltlichen und geistigen Pfennige kennzeichnet ein hohlförmiger Rand, der mit Lilien, Halbmonden oder A...
Mercandetti, Tommaso
Der bedeutende italienische Medailleur und Stempelschneider kam als Sohn des römischen Stempelschneiders Pietro Mercandetti schon früh mit der Herstellung von Münzen und Medaillen in Berührung. Nach der Ausbildung bei dem Gemmenschneider Girolamo Rossi stellte ihn die päpstliche Münze in Rom bereits 1773 ein. Er schuf eine Reihe von Münzen für die Päpste Pius VI. (1774-1799) und Pius VII. (1799-1823), seit 1796 war er erster Graveur an der päpstl...
Merchant Bankers
Auch Kaufleute-Bankiers, ist die Bezeichnung für Häuser, die Handel und Bankgeschäft miteinander verbanden. Die ersten kombinierten Banken- und Handelsgesellschaften kamen im 13. Jh. aus der Toskana (u.a. Bardi und Peruzzi). Neben Fernhandel und Wechselgeschäften betätigten sie sich auch als Steuerpächter und Kreditgeber für Fürsten und Päpste. Im 15. Jh. waren die Medici (Florenz), im 16. Jh. die Fugger (Augsburg) die wichtigsten Finanz- und Handels...
Merk
Von Mark abgeleitete, schottische Bezeichnung für ein Gewicht, dann für Rechnungsgeld. Als Balance Half Merk (1591/92) und als Thistle Merk (1601-1604) auch als Münze ausgeprägt.
Merkur
Mecurius
Römischer Gott des Handels und Verkehrs, auch im Sinne von List, Verschlagenheit, im 4. Jh. v. Chr. allmählich dem griechischen Gott Hermes angeglichen. Auf römischen Münzen meist als unbekleidete Ganzfigur, stehend, mit Geldbeutel und Caduceus in Händen dargestellt.
Merowingische Münzen
Merowingische Münzen zählen zu den Prägungen der Völkerwanderungszeit im frühen Mittelalter. Sie sind nach dem fränkischen Königsgeschlecht der Merowinger benannt, die im 5. Jh. das Frankenreich gründeten. Im 6. Jh. durch Bruderzwiste und Reichsteilungen geschwächt, verloren sie im 7. Jh. die Macht allmählich an die Hausmeier aus dem Geschlecht der Karolinger, die 751 n. Chr. schließlich den fränkischen Königsthron übernahmen.
Die Merowinger-Münzen waren kleiner im Durchmesser, di...
Messergeld
Dao
Vormünzliche Zahlungsmittel in Form von Messern kommen in den verschiedensten Kulturen und zu verschieden Zeiten vor. Die interessanteste Frühform ist das chinesische Messergeld.
Chinesisches Messergeld
Ursprung des Messergeld
Als Ursprungsgebiet wird der Osten der Halbinsel Shadong angenommen, denn außer dem Messergeld wurde dort kein anderes Zahlungsmittel gefunden. In den Staaten der sogenannten Ostbarbaren (Ji-Mo, An-Yang), die im 7. Jh. v. Chr. von ihrem westlichen Nachbarn Qi erobe...
Messermünzen
Vormünzliche Zahlungsmittel in Form von Messern kommen in den verschiedensten Kulturen und zu verschieden Zeiten vor. Die interessanteste Frühform ist das chinesische Messergeld, als Ursprungsgebiet wird der Osten der Halbinsel Shadong angenommen, denn außer Messergeld wurde dort kein anderes Zahlungsmittel gefunden. Das chinesische Messergeld zählt zu den Gerätemünzen, denn einerseits ist der Form des Messergeldes noch anzusehen, dass es vom Gebrauchsgegenstand Messer abgeleitet ist, ande...
Messing
Bezeichnung für Legierungen aus Kupfer (55-90%) und Zink (10-45%), in Sonderformen sind auch noch Beigaben von Aluminium, Blei, Mangan, Nickel, Silizium, Zinn und Eisen enthalten. Bestimmte Legierungen mit hohem Kupferanteil werden Tombak genannt. Man unterscheidet Gelb- (70% Kupfer), Gold- (85% Kupfer) und Rottombak (90%Kupfer). Die Verwendung von Messing beruht, neben der hohen Dehnbarkeit und guten Korrosionsbeständigkeit, vor allem auf der Wandlungsfähigkeit der Eigenschaften, je nach Bea...
Mestrelle, Elois
Französischer Münzgraveur und Münztechniker, der an der Münzstätte in Paris angestellt war. Die von Mestrelle bevorzugte maschinelle Münzprägung mit dem Spindelprägewerk stieß auf die Ablehnung der Pariser Münzarbeiter, die bald wieder zur Handprägung mit dem Hammer übergingen. Frustriert ging Mestrelle 1561 nach England und erhielt die Erlaubnis, einSpindelprägewerk und ein Rosswerk zu errichten. Im Juli desselben Jahres soll K&...
Metalle
Stoffe mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit, die bei Zimmertemperatur (mit Ausnahme des Quecksilbers) feste und kristalline Formen bilden und einen charakteristischen Glanz ausstrahlen. Mit steigender Temperatur nimmt die Leitfähigkeit der Metalle ab. Nach ihrer Beständigkeit gegenüber Wasser und Luft unterscheidet man edle (Gold, Platin und Silber) und (oxidierende) unedle Metalle (z.B. Kupfer und Eisen). Nach ihrer Dichte werden sie in Leichtmetalle (bis 5), wie Aluminium o...
Metallgeld
Traditionell gehören zum Metallgeld verschiedene Edelmetalle, Buntmetalle und Eisen in Form von:
Barren
Stäben
Ringen
Scheiben
Drähten
Stücken
Körnern
Hackmetall
Meist sind sie von bedeutenden Handelsvölkern benutzt worden und sind schon seit frühgeschichtlicher Zeit bekannt. Das Metall(barren)geld wurde nach Gewicht oder in standardisierter Form bewertet. Edelmetallbarren fanden dabei vor allem im Fern- und Großhandel Verwendung.
Das könnte Sie auch interessieren:
Metalle
Met...
Metallismus
Eine Geldwerttheorie, die im Gegensatz zumNominalismus den Wert des Geldes aus seinem inneren Wert bestimmt.
Metallkunde
Lehre von den Eigenschaften metallischer Werkstoffe ( Metalle und Legierungen).
Metallurgie
Auch Hüttenkunde, ist die Lehre von der Technik der Gewinnung und der Verarbeitung von Metallen.
Metallwert
Der innere Wert einer Münze, im Gegensatz zum vom Münzherrn/Gesetzgeber vorgeschriebenen Nennwert. Auch in den Zeiten der Edelmetallwährungen war der Nennwert einer Münze in der Regel höher als der Metallwert (Ausnahmen siehe Münzwert und Nennwert). Die Differenz setzte sich aus den Prägekosten, dem Schlagschatz, einem Kulanzwert (Remedium) und evtl. aus dem Münzgewinn zusammen und konnte bis zu 50% betragen. Durch ansteigende Kosten auf dem Edelmetallmarkt konnten Münzen einen höheren...
Methuen-Vertrag
Der am 27. Dezember 1703 zwischen Portugal und England abgeschlossene Vertrag ist nach dem englischen Diplomaten John Methuen benannt. Der Vertrag erlaubte eine zollgünstige Einfuhr von portugiesischem Wein (Portwein, Sherry) gegen eine Bevorzugung englischer Textilien. Die gegenseitigen Vereinbarungen waren ursprünglich gegen die französische Wirtschaft gerichtet. Die Konsequenzen des Vertrags waren weitreichend: Wirtschaftlich wurde Portugal (Agrarstaat) von dem Industriestaat England abhä...
Metica
Metical
Währungsbezeichnung der Volksrepublik Mosambik seit der Erlangung Unabhängigkeit (zuvor portugiesisch) des afrikanischen Staats 1975: 100 Céntimos = 1 Metica (Plural Meticas). Seit der Währungsreform vom 16. Juni 1980 gilt die Währungsbezeichnung Metical (Plural Meticais), unterteilt in 100 Centavos. Im Jahr 1990 hat sich die ehemalige Volksrepublik in Republik Mosambik umbenannt.
Metrologie
Wissenschaft von den Maßen, Gewichten und Zahlen, vom Messen, Wiegen, Zählen und Rechnen. Die historische Metrologie hat in Bezug auf die Numismatik die Münzgrundgewichte, Rau- und Feingewichte, den Münzfuß, den Metallwert und die Einheit des Währungsmetalls zum Gegenstand. Die Münze erscheint als physikalische Größe aus einer Zahl und einer Einheit, die über ein Netz von Vergleichen und Einteilungen gewonnen werden. Die historische Metrologie...
Metzblanken
Spätmittelalterliche Groschenmünze aus der freien Reichsstadt Metz, die nach dem Vorbild des französischen Blanc geprägt wurde. Sie wurde zum Vorläufer der im Rheinland geprägten Blanken.
Mexico Dollar
Beiname des Dollar genannten Peso zu 8 Reales (Peso de a Ocho), nach der Münzstätte Mexiko-Stadt benannt, in der diese bekannte Weltmünze in riesigen Stückzahlen geprägt wurde. Die spanischen Kolonisten gründeten 1536 in Mexiko-Stadt die erste Münzstätte der "Neuen Welt", die bis ins beginnende 19. Jh. die einzige Münzstätte des silberreichen Landes blieb. Schätzungen besagen, dass von der Eröffnung der Münze bis 1888 mehr als 3 M...
Mezzo Scudo Romano
Vatikanische Goldmünze zu 50 Baiocci, die unter den Päpsten Clemens XII. (1730-1740), in der Sedisvakanz 1740 und unter Benedikt XIV. (1740-1758) gemünzt wurde. Letzterer begann auch die Prägung des Mezzo Scudo Romano in Silber als Halbstück der päpstlichen Scudoprägung, die sich über 250 Jahre erstrecken sollte.
Michaut, Auguste François
Französischer Bildhauer, Medailleur und Münzstempelschneider, Schüler von André Galle, schnitt unter den Königen Louis XVIII. (1814-1830) und Charles X. (1834-1830) eine ganze Reihe von Proben und Münzen (Signatur meist MICHAUT F). Der Künstler schuf auch eine Reihe von Porträt-, Ereignis- und Preismedaillen.
Medaille von Michaut auf den Einzug von König Charles X. in Versailles
Mijten
Miten
Bezeichnung für die in Brabant und Flandern seit der Mitte des 15. Jh.s geschlagenen geringwertigen Billonmünzen, die seit Karl V. (1506-1555) in reinem Kupfer ausgegeben wurden. Schrötter vermutet eine Ableitung des Namens Mijt von der Münzbezeichnung Maille. Der Großteil der Mijten (deutsch meist in der Schreibweise Miten) wurde in Mehrfachnominalen ausgegeben. Im 16. Jh. waren die Mijten die kleinste Münzsorte: 3 Brabanter Mijten = 2 flandrische Mijten = 1 Korte. Die Münze wurde ...
Mil
Bezeichnung von Kleinnominalen (vom lat. millesimum = ein Tausendstel), die in verschiedenen Ländern unter britischem Einfluss im 19./20. Jh. als Tausendstelunterteilung der Währungseinheit eingeführt wurden.
1. Zuerst bezeichnete Mil eine Kleinmünze, die nur 1863-1866 als Unterteilung des Hongkong-Dollar in der britischen Kronkolonie gemünzt wurde. Sie zeigt in der Mitte ein Loch in einem quadratischen Rahmen. Die Vs. ist mit der Jahreszahl (nach gregorianischem Kalender), der Landes- und ...
Milan d'or
Beiname der serbischen Goldmünzen zu 10 und 20 Dinar, die Prinz und König Milan (1868-1889) in Anlehnung an die Währung der Lateinischen Münzunion in den Jahren 1879 und 1882 in zwei Typen prägen ließ. Die von Ernest Pauline Tasset 1879 gravierten 20-Dinar-Stücke zeigen auf der Rs. Wertzahl, Wertbezeichnung und Jahreszahl im Kranz, auf der Vs. das Kopfbild, in der Umschrift den vollen Namen (Milan Obranovitsch IV.). Besonders die wenigen Proben gelten in Samml...
Miliarense
Auch Miliaresia, bezeichnet eine Silbermünze aus der späten römischen Kaiserzeit, die unter Konstantin dem Großen um 320 v. Chr. zum ersten Mal gemünzt wurde. Eigentlich handelt es sich um zwei Münzen: Neben den am häufigsten ausgegebenen Leicht-Miliarense, im Gewicht von ca. 4,55 g kamen auch sog. Schwer-Miliarense im Gewicht von etwa 5,5 g vor. Ursprünglich bedeutet Miliarense wohl 1/1000 des römischen Goldpfundes, auf das 72 Solidi gehen. Daraus ergibt sich: 1 Solidus = 14 Schwer-Mil...
Miliaresion
Griechische Bezeichnung für den Miliarense (lat. Miliaresia) im griechischsprachigen Oströmischen Reich und dem nachfolgenden Byzantinischen Reich.
Milled coins
Englischer Ausdruck für maschinengeprägte Münzen, im Gegensatz zu hammered coins, Handprägungen unter Zuhilfenahme des Hammers. Viele Sammler britischer Münzen haben sich auf eines dieser beiden Spezialgebiete festgelegt. Obwohl auf dem von Mestrelle in London errichteten Spindelprägewerk zwischen 1561 und 1570 die ersten milled coins hergestellt wurden, blieb die mechanische Prägung zunächst nur Episode, ebenso wie die unter König Charles I. (1625-1649) mittels Walzenprägung hergestel...
Millefiori-Perlen
Bezeichnung aus dem Italienischen (Millefiori, wörtlich 1000 Blumen) für Glasperlen, die mit Blumenmustern versehen sind. Verschiedene Perlen, die in weiten Teilen Afrikas als Wertobjekte, Handelsperlen oder zu Tausch- und Zahlungszwecken dienten, waren mit Blumenmustern versehen, z.B. viele Sorten der Akoriperlen.
Millenniummünzen
Millenniummedaillen
Münzen oder Medaillen, die aus Anlass einer Jahrtausendfeier (Millennium) herausgegeben werden. Eine ganze Reihe von Münzen des römischen Kaisers Philippus I. Arabs nehmen Bezug auf die pompöse Jahrtausendfeier Roms, die im April 248 v. Chr. mit einjähriger Verspätung stattfand. In Sammlerkreisen gesucht sind vor allem Antoniniane und Sesterze, die auf der Rs. Tierbilder zeigen und mit der Legende SAECVLARES AVGG oder SAECVLVM NOVVM beschriftet sind. Die Gepräge zeigen...
Millim
Millième
Bezeichnung von Unterteilungen der Währungseinheiten in Tausendstel in einigen islamisch geprägten arabischen und afrikanischen Staaten. 1. Die ägyptischen Millims oder Millièmes laufen als 1/1000 des Ägyptischen Pfundes seit 1916 in Nominalen von 1, 2, 5 und 10 (selten 1/2 und 2 1/2) Millièmes um. Die ägyptische Millième-Prägung ist sehr vielfältig: Es gibt Stücke mit Loch in der Mitte, mit welligen Rändern (Wellenschnitt), achteckige und runde Stücke, frühe Milliè...
Milreis
Portugiesische Münzeinheit, wörtlich 1000 Reis, wurde 1854 mit der nun auch faktisch (durch Münzgesetz) anerkannten Goldwährung zur Rechnungseinheit. Basis der Goldwährung war die Goldkrone (Corõa d'ouro) zu 10 Milreis. Es gab auch Nominale zu 5, 2 1/2, und 1 Milreis. Die Silbermünzen zu 1000, 500, 200, 100 und 50 Reis wurden zu Scheidemünzen, die letzten beiden Nominale wurden um 1900 in Kupfer geprägt. Nach der Wirtschaftskrise um 1891 blieben zwar die Goldmünzen mit einem Agio verse...
Mine
Alte orientalische Gewichtseinheit, die von den Griechen übernommen wurde. Sie stellte 1/60 Talent dar und zerfiel in 100 Drachmen, im Orient in 60 Schekel. In den Kleinstaaten des antiken Griechenlands bildeten sich verschiedene lokale Minen zu unterschiedlichen Gewichten, die zu verschiedenen Münzfüßen führten. Der wichtige attische Münzfuß beruhte auf einem Gewicht der Mine, das etwa 436,6 g entsprach.
Minerva
Schutzgöttin der Handwerker, Künstler und der Stadt Rom (in der Trias Jupiter-Juno-Minerva). Minerva wurde der griechischen Göttin Athene gleichgesetzt. Sie erscheint auf römischen Münzen der Kaiserzeit behelmt und mit den Attributen Speer und Schild.
Darstellung der Minerva auf einem As des Domitianus
Ming-Messer
Die bekannteste und am häufigsten gefundene Sorte des späten chinesischen Messergelds. Die Ming-Messer zählen zu den chinesischen Gerätemünzen. Die Bezeichnung bezieht sich auf das chinesische Schriftzeichen Ming (hell), das auf der Vs. der Klinge vorkommt. Die Ming-Messer wurden vor allem im Norden und Osten Chinas gefunden, wo sie zwischen dem 5. und 3. Jh. v. Chr. als Zahlungsmittel im Umlauf waren. Man unterscheidet nach der äußeren Form zwei verschiedene ...
Miniassegni
Italienische Bankanweisungen und Kleinschecks zu niedrigen Werten, die seit 1975 als eine Art papiernes Notgeld umlaufen (ital. Assegni = Anweisungen).
Minimi
Bezeichnung winziger Münzen, die von einigen Sammlern speziell gesucht werden. Das vom lat. minimus abgeleitete Wort bedeutet "die Kleinsten". Kleine Bronzemünzen liefen in spätrömischer Epoche, zur Völkerwanderungszeit und im frühen Mittelalter um. Zu den kleinen Bronzemünzen zählen aksumitische Münzen und die Stycas, die seit der Mitte des 9. Jh.s im Königreich Northumbria und im Erzbistum York umliefen. Wenn die Sammlung von Minimi auf kleine Silber- und Goldmünzen ausgedehnt ...
Minotaurus
Der Sage nach ein kretisches Ungeheuer, das als Sohn der Königin Pasiphae und eines Stiers im Labyrinth von Knossos hauste. Der Mann mit Stierkopf forderte Menschenopfer, bis er von Theseus erlegt wurde. Auf einigen griechischen Münzen der Antike ist der Minotaurus als Knielauf-Figur dargestellt.
Minuskel
Kleinbuchstabe, vom lat. minusculus (ziemlich klein), der im Gegensatz zur Majuskel selten zur Beschriftung von Münzen diente.
Mionnet, Théodor Edmé
Der französische Numismatiker stellte aus den Beständen des Cabinet des Médailles der Bibliotheque Nationale einen sorgfältigen Katalog griechischer und römischer Münzen zusammen, der zum ersten Mal Schönheitsgrade und Bewertungen enthielt. Zur Größenbestimmung erfand Mionnet die nach ihm benannte Skala aus 19 sich vergrößernden Kreisen.
Miscellaneamedaillen
Auch Miszellenmedaillen, ist die Sammelbezeichnung für Medaillen, die nicht in die traditionellen Bereiche wie Personen- oder Ereignismedaillen passen. Sie fallen in den Bereich "vermischte Medaillen", wenn der Ausstoß nicht bedeutend genug scheint, um einen eigenen, thematisch abgegrenzten Bereich zu bilden. Das Wort kommt vom lat. miscellus (vermischt) und ist vermutlich aus dem lat. Ausdruck miscellanea für die gemischte, spärliche Gladiatorenkost in der Neuzeit in die Numismatik übernom...
Mitako
Bezeichnung von Kupfer- und Messingdrähten, die in Westafrika, vor allem im Kongogebiet, als universelles Zahlungsmittel kursierten. Die von den Europäern eingeführten Drahtrollen und abmontierten Telefondrähte hatten ursprünglich eine Länge von 50 cm, bei einem Durchmesser von 3 bis 4 mm. Es gab einen hohen Bedarf an solchen Drähten, denn sie dienten zur Herstellung von Ketten und Armbändern. Die aus den Drähten gefertigten Glieder konnten zu kunstvo...
Mitkal
Ursprünglich ein Gewicht im Edelmetallhandel islamischer Staaten. Im marokkanischen Münzsystem des 17./18. Jh.s wurde der Mitkal in Silber nach dem Vorbild des Piaster ausgeprägt. Bei einem Gewicht von etwa 28,5 g galt er 10 (später 13 1/2) Dirham; es gab auch Halbstücke. Der goldene Mitkal galt 1/2 Bunduki, 4 Goldmitkal entsprachen dem Wert eines goldenen 20-Francs-Stücks.
Mitra
Kopfbedeckung geistlicher Fürsten (Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte), ursprünglich eine Mütze mit zwei herabfallenden Bändern( Infula). Durch den seitlichen Einschnitt entwickelte sie sich zu einer verzierten Bischofsmütze, die auf mittelalterlichen Münzen geistlicher Münzherren dargestellt ist. Die Gepräge mittelalterlicher und neuzeitlicher Münzen zeigen auch Wappen geistlicher Würdenträger, auf denen statt Kro...
Mittel-August d'or
Nach der Eroberung Sachsens im Siebenjährigen Krieg ließ der preußische König Friedrich der Große in den Jahren 1758 bis 1760 die sächsische Pistole (August d'or) - im Goldgewicht vermindert (4,2 g) - mit den Originalstempeln der Jahre 1755 und 1756 nachprägen. So konnte der preußische König zunächst unbemerkt Gold abzweigen, das er dringend zur Finanzierung des Krieges benötigte. Später folgte sogar noch eine weitere Verminderung des Feingewichts (Neuer August d'or).
Mittel-Friedrich d'or
Unterwertig ausgebrachter goldener Friedrich d'or, den König Friedrich der Große während des Siebenjährigen Kriegs in den Jahren 1758-1763 mit vermindertem Feingewicht (4,2 g statt 6,05 g) münzen ließ. Die Münzen sind etwas dicker als die vollwertigen Friedrich d'ors und besitzen eine rötliche Färbung. Es sind etwa 1 1/2 Millionen Stücke geprägt worden, der Großteil wurde nach dem Krieg wieder eingeschmolzen, der Rest verblieb bis 1871 im Wert von 3 Talern und 27 Silbergroschen im Za...
Mittelalter
Bezeichnung der Epoche zwischen Altertum und Neuzeit, die in Früh- (6.-9. Jh.), Hoch- (10.-13. Jh.) und Spätmittelalter (14./15. Jh.) eingeteilt ist. Anfang und Ende des Mittelalters sind umstritten: Manche Periodisierungen lassen das Mittelalter bereits mit der beginnenden Völkerwanderungszeit (um 375 v. Chr.), dem Ende des Weströmischen Reichs (476) oder mit Karl dem Großen (um 800) beginnen. Aus numismatischer Sicht ist die Pfennigprägung charakteristisch fü...
Mittelbronzen
Nach der Einteilung der römischen Æ-Münzen der Kaiserzeit zählen dazu Bronzemünzen mit einem Durchmesser von 23 bis 29 cm. Darunter fallen Asse und einige Dupondien sowie der Follis der Anfangszeit unter Kaiser Diokletian.
Moco
Bezeichnung des Mittelstücks des zerschnittenen Peso in San Domingo. Die Stücke sind mit D gegengestempelt worden.
Model Penny
Bezeichnung eines inoffiziellen englischen Penny aus Kupfer mit einem Mittelstück aus Silber, das den Kopf der Königin Viktoria zeigt. Die beliebte Kleinmünze wurde um 1845 in der Birmingham Mint als Modell eines neuen Penny geprägt.
Modell
Seit der Renaissance werden zur Herstellung von Prägewerkzeugen bzw. beim Medaillenguss Entwürfe oder Muster hergestellt. Zur Herstellung von Stempeln und Rändelbacken schneidet der Medailleur oder Graveur mit Stichel und Schabwerkzeugen das Motiv vergrößert mit erhabenem Relief (positiv). Diese Urmodelle sind in der Regel aus Gips oder sonstigen gut verarbeitbaren Materialien (Wachs, Buchsbaum, Stein oder Ton). Durch zweimaliges Abgießen (Zwischenmodelle) wird ei...
Modius
Lateinisch für den Getreidescheffel, bei den Römern ein Holzgefäß mit Dauben und Beschlägen, das auf römischen Münzen häufig als Attribut der Göttin Annona und der Ceres erscheint. In Verbindung mit Annona ragen aus dem Gefäß oben häufig Ähren heraus, in Verbindung mit Ceres Mohn. Der Modius erscheint gelegentlich auch als alleiniges Münzbild, z.B. auf der Vs. von Kleinbronzen (Quadrans) unter Kaiser Claudius (41-54 v. Chr.). Auf griechischen Münzen der hellenistischen Zeit wurde ...
Moeda de ouro
Portugiesische Bezeichnung für das goldene 4-Cruzado-Stück. Der Name (wörtlich eigentlich Geld aus Gold) wurde schon 1575 für ein Goldstück zu 500 Reis verwendet und in der Folgezeit auf mehrere Nominale übertragen. Mit der Erhöhung des Cruzado auf 1000 Reis im Jahr 1662 ging der Name auf das Vierfachstück zu 4000 Reis über. Unter der Bezeichnung Moidor entwickelte sich diese Goldmünze zur Haupthandelsmünze Portugals. Sie zeigt auf der Vs. d...
Moffat & Co.
US-amerikanische Firma, die während des kalifornischen Goldrauschs in San Francisco privat Gold ausmünzte. Moffat & Co begann im Sommer 1849 mit der Ausgabe von Goldbarren in Werten von 9,43 bis 264 Dollar, die heute fast alle eingeschmolzen sind. Lediglich zwei Barren zu 9,43 und 14,25 und wenige zu 16 Dollars sind erhalten. In den Jahren 1849/50 ließ die Firma 5- und 10-Dollar-Stücke schlagen. Die Stempel der 10-Dollar-Stücke wurden von dem aus Bayern stammenden A...
Mohar
Bezeichnung der nepalesischen Währungseinheit des 19. und frühen 20. Jh.s. Das im Himalaja-Massiv gelegene Königreich Nepal wurde 1769 von einem Fürsten der eingewanderten Gurkha gegründet. Trotz seiner Lage als Pufferstaat zwischen China und Indien blieb der Staat selbstständig mit eigener Münzhoheit. Die Bezeichnung Mohar geht wohl auf den Mohur des indischen Mogulreichs zurück. Der Nepali-Mohar war ein festes Edelmetallgewicht von 5,5 g Gold oder Silber...
Möhrchen
Auch Morgin oder Moergen, sind volkstümliche Bezeichnungen für die rheinischen Hohlringheller, vor allem in Köln. Der Beiname hat sich aus der schwarzen Farbe entwickelt, die die Stücke nach Abnutzung der dünnen Silberlegierung im Umlauf annehmen, und trifft wohl besonders auf die aus reinem Kupfer geprägten Näpfchenheller aus dem 17. Jh. zu.
Mohur
Indische Goldmünze, die von Großmogul Akbar (1556-1605 n. Chr.) eingeführt wurde und beständig bis zum Ende des Mogulreichs (Mitte des 19. Jh.s) und darüber hinaus geprägt wurde. Die Benennung kommt aus der persischen Sprache, von mur (Siegel) oder muhur (Siegelring) abgeleitet. Je nach Zeit und Gewicht wurde der Mohur mit 9 bis 16 (silbernen) Rupien bewertet. Während der Regierungszeit Akbars umfasste die reiche Mohurprägung - neben dem einfachen Mohur -...
Moidor
Bezeichnung der portugiesischen Welthandelsmünze Moeda deouro. Das Wort Moidor (frz.: Moidore) ist vermutlich aus der Zusammenziehung von Moeda de ouro entstanden.
Moka-Kina
Sakrales Wertobjekt, das bei der Moka-Zeremonie, einem rituellen Geschenkaustausch, und als Brautpreis im Hochland von Papua-Neuguinea eine große Rolle spielt. Es besteht aus einer Kinamuschel, die zusammen mit einem Bambusröhrchen in eine mit Rötel gefärbte Holzplatte eingebettet ist. Die Kinamuschel war im Hochland von Neuguinea ein beliebtes Wertobjekt und Zahlungsmittel, das der heutigen Währung von Papua-Neuguinea ihren Namen gab.
Mokko
Bezeichnung der Bronzetrommel, die zwischen dem 17. und dem beginnenden 20. Jh. auf den im Osten Indonesiens gelegenen Kleinen Sundainseln Alor und Pantar als Hauptzahlungsmittel in Gebrauch war. Die aus zwei oder drei gegossenen Teilen zusammengesetzten Stücke in Sanduhrform sind etwa 30-70 cm hoch und etwa 2,5 bis 10 kg schwer. Für das europäische Auge sind sie nicht als Trommeln zu erkennen, sie sehen eher aus wie zwei gegeneinander gerichtete "Blumenuntertöpfe" in Tulpenf...
Molluskengeld
Der wissenschaftlich exaktere Begriff Molluskengeld löst den traditionellen Ausdruck Muschelgeld ab, der sich fälschlicherweise für das Geld eingebürgert hatte, das zum Großteil aus den Gehäusen verschiedener Arten von Schnecken besteht, seltener aus Muschelschalen. Diese Tatsache in Verbindung mit einer größeren wissenschaftlichen Exaktheit trägt der Umbenennung in Molluskengeld Rechnung, die sich jedoch im numismatischen Sprachgebrauch nur allm&au...
Mon
Altjapanische Kupfermünze mit einem rechteckigen Loch in der Mitte, die wohl nach dem Vorbild der Cash auf dem asiatischen Festland von ca. 1616 bis 1868 ausgemünzt wurde. Es gab 1- und 4-Mon-Stücke, letztere gelegentlich auch aus Eisen oder Messing. In den frühen 60er Jahren des 19. Jh.s wurden auch einige Lokalausgaben in Nominale zu 16, 24, 50, 100 und 200 Mon aus Bronze oder Blei gegossen.
Moneda de necesidad
Auch Moneda provisional, ist die spanische Bezeichnung für Notgeld, Belagerungsmünzen und Klippen.
Monedas de molino
Spanischer Ausdruck für die mechanische Prägung, die im ausgehenden 16. Jh. zuerst in der Münzstätte Segovia eingeführt wurde. Der Ausdruck entspricht in etwa dem frz. Monnaies du moulin oder dem engl. milled coins. Allerdings richteten die Münztechniker in Spanien nicht Spindelprägewerke ein wie in Frankreich oder England, sondern bevorzugten Walzenwerke, wie es sie seit Mitte des 16. Jh.s schon in der Münzstätte Hall (Tirol) gab.
Monepigraphische Münzen
Bezeichnung für Gepräge, die keine Münzbilder zeigen, sondern nur beschriftet sind, wie z.B. die Mehrzahl der islamischen Münzen.
Moneta
Beiname der römischen Göttin Juno, ursprünglich vielleicht eine eigenständige Gottheit, die dann mit Juno verschmolzen wurde. Die Bedeutung von Moneta für Münze, Geld kommt möglicherweise daher, dass man im Tempel der Juno Moneta auf dem Kapitol in Rom Münzen prägte. Die Ableitung des Wortes Moneta von "monere" (mahnen), also "die Mahnende", ist nicht gesichert, auch eine Ableitung mit direkterem Bezug auf das Münzwesen ist denkbar. Aus dem lat. Moneta leiten sich in den romanisch-spra...
Moneta palatina
Auch Moneta palati, findet sich als Inschrift auf Münzen des Frühmittelalters und besagt, dass die betreffenden Münzen am Königshof geprägt wurden, ganz gleich, wo er sich gerade befand. Zu den frühesten Münzen mit dieser Aufschrift zählt eine Münze von König Dagobert I. (628-638 v. Chr.), die vom heiligen Eligius am Hof des Merowingerkönigs geprägt worden sein soll. Die Frankenkönige und -kaiser hatten keine feste Hauptstadt und zogen in ihrem Reichsgebiet von Palast zu Palast, je ...
Monetarius
Bezeichnung für Münzer und Münzarbeiter in lateinischen Dokumenten( Münzberufe).
Mongo
Bezeichnung der Unterteilung der mongolischen Münzeinheit im Dezimalsystem: 100 Mongo = 1 Tugrik. Der Mongo wurde in verschiedenen Nennwerten nach der Ausrufung der Volksrepublik Mongolei am 26. November 1924 geprägt, zunächst in Kupfer (1, 2 und 5 Mongo) und Silber (10, 15, 20 und 50 Mongo), seit 1937 in Aluminiumbronze und Kupfer-Nickel. Die Stücke zeigen auf den Vs.n das Soyombo-Emblem und altmongolische Inschriften. Die Jahresangaben beziehen sich bis 1945 auf die neumong...
Monnaies de confiance
Monnerons
Auch Medailles de confiance genannt, wurden 1791/92 in Frankreich nach der Französischen Revolution aufgrund des Mangels an staatlichem Kleingeld von Gemeinden, Körperschaften und Banken ausgegeben. Die Ausgabe von Monnaies de confiance und ihrer papiernen Gegenstücke (Billets de confiance) sollte den Kleingeldmangel in den Wirren der Revolutionszeit mildern. Es handelte sich meist um kupferne Mehrfachstücke (2, 5, 10, 15, 20) des Sol, eine Manufaktur stellte sogar Porzellangeld he...
Monnaies du moulin
Bezeichnung für die ersten französischen Münzen, die 1550-1559 mittels mechanischer Prägung hergestellt wurden. Der französische König Henri II. (1547-1559) ließ 1551 in seinem Pariser "Maison des Etuves" (auf der Ile de Cité) eine Prägestätte errichten, die speziell für das aus Deutschland importierte Spindelprägewerk eingerichtet wurde. Die Münze wurde "Moulin des Etuves" genannt, weil sie durch ein Mühlrad per Wasserkraf...
Monogramme
Ursprünglich Einzelbuchstaben, dann mehrere zu einem einheitlichen Zeichen zusammengefügte Buchstaben, die seit der Antike häufig auf Münzen verwendet werden. Auf griechischen und römischen Münzen erscheinen Monogramme meist als Abkürzung für Münzstätten und Münzbeamte. Im Byzantinischen Reich setzte sich die Verwendung der Monogramme auf Münzen und Siegeln fort und wurde auch auf nachgeahmten Münzen während der germanischen Völkerwanderungszeit von Ost- und Westgoten, Burgunder u...
Monometallismus
Eine Edelmetallwährung, bei der im Gegensatz zum Bimetallismus nur ein Edelmetall frei ausprägbar ist, entweder die Goldwährung (Monochrysismus) oder die Silberwährung (Monoargyrismus). Verschiedene Goldwährungen kamen im 19. Jh. häufig vor, z.B. in England (seit 1816), den Niederlanden (seit 1875), Deutschland und den Staaten der Skandinavischen Münzunion (seit 1873). Die Silbermünzen wurden bei Goldwährung meist zu Scheidemünzen, die (ebenso wie die Banknoten) von den nationalen Note...
Moraglia
Bezeichnung der Billonmünze zu 3 bzw. 2 Soldi, die in einigen nord- und mittelitalienischen Staaten im 16./17. Jh. geprägt wurde. In Modena wurde sie auch als Baiarda, im Kirchenstaat als Muraiola bezeichnet.
Morgan Dollar
Bezeichnung des silbernen US-Dollartyps zwischen 1878 und 1921, nach dem Münzgraveur George D. Morgan benannt, der den Entwurf besorgte. Die Vs. des variantenreichen Typs stellt den Freiheitskopf (Liberty Head) nach dem Bildnis der Anna W. Williams dar, in der Umschrift das Motto E PLURIBUS UNUM (Aus Vielem zum Einen) umgeben von 13 Sternen, im Abschnitt die Jahresangabe. Die Rs. zeigt den Adler, in den Klauen Zweig und Blitzbündel, Landes- und Wertbezeichnung, darüber das Motto IN GOD WE TRU...
Moritzpfennige, -münzen
Allgemeine Bezeichnung von Pfennigen und Münzen, die Sankt Moritz auf dem Münzbild zeigen. Der heilige Moritz erscheint u.a. auf Münzen von Coburg (Pfennige aus dem 14. Jh.) und Savoyen (z.B. Scudo 1616/18). Im engeren Sinn sind mit Moritzpfennigen die Magdeburger Silberpfennige aus dem 11. bis ins 15. Jh. gemeint, die den Patron des Erzstiftes zeigen. Die frühesten sind zweiseitige Denare aus der Zeit Kaiser Heinrichs III. (1039-1056), die auf der Hauptseite das Kopfbild des Domheiligen von...
Mormon Gold
In dem von den Mormonen organisierten Gebiet, dem "State of Deseret" (Staat der Honigbiene) wurde in der Mitte des 19. Jh.s auch Gold gefunden, das zwischen 1849 und 1860 in Salt Lake City auf Initiative von Bringham Young ausgemünzt wurde. Die Goldstücke in Nennwerten zu 2 1/2, 5, 10 und 20 Dollars zeigen auf der Vs. das Auge Gottes, darüber den Bischofshut und die Umschrift HOLINESS TO THE LORD. Die Rs. zeigt zwei verschlungene Hände, darunter Jahreszahl und Wertangabe, im ...
Morsezeichen
Nur auf den kanadischen Gedenkmünzen zu 5 Cents (1943-1945) kommen Morsezeichen vor, und zwar auf dem zwölfeckigen Rand der Münzrückseite. Sie nimmt Bezug auf den 2. Weltkrieg und zeigt ein V zwischen einer Fackel, das sowohl als römische Wertzahl (5) wie auch als ein Zeichen für Victory (Sieg) gedeutet wird. Die Morsezeichen bedeuten "we win when we work willingly" (Wir gewinnen, wenn wir willig arbeiten).
Moskovka
Bezeichnung der Denga von Moskau im 16. und 17. Jh., die zwar spärlich ausgeprägt wurde, aber als Rechnungsmünze bedeutend war. Die doppelte Denga wurde Kopejka( Kopeke) genannt.
Motivsammlungen
Münzsammlungen nach bestimmten Motiven und nicht nach strengen historischen oder geographischen Gesichtspunkten. Sammelgebiete nach Motiven können kulturgeschichtlich oder ästhetisch sehr interessant sein und auf bestimmten Gebieten auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Die Meinung, das Motivsammeln ginge auf die Philatelie zurück, ist ein weitverbreiteter Irrtum, denn Numismatiker, Kunst- und Kulturhistoriker sammelten schon Münzen nach Motiven, als es noch keine Briefmarken gab. A...
Mott Token
US-amerikanisches Kupferstück ohne Wertangabe, das nach dem Herausgeber, der Firma William & John Mott benannt ist, die in New York u.a. mit Uhren, Gold- und Silberwaren handelte. Die Stücke zählen zu den ersten von einer amerikanischen Firma hergestellten Token und zeigen auf der Vs. Adler und Jahresangabe, auf der Rs. eine Standuhr.
Motto
Auch Leit-, Sinn- oder Wahlspruch, erscheint auf Münzen in der Neuzeit als Ergänzung zu einem Sinnbild. Die Mottos dienten zur Erläuterung der Sinnbilder und waren vor allem auf barocken Geprägen beliebt.
Mouton d'or
Auch Agnel oder Aignel (Lamm), ist eine französische Goldmünze, die König Philipp IV. „der Schöne“ (1285-1314) um 1311 im Gewicht von etwa 4,2 g einführte. Die Goldstücke im Wert von 20 Sols tournois aus fast reinem Gold zeigen auf der Vs. das Lamm mit Kreuz und Banner, mit der lat. Umschrift nach dem Evangelium von Johannes (I, 29): AGN(US) D(E)I QVI TOLL(IS) P(E)CCA(TA) MU(N)D(I) MISERERE NOB(IS), (Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser). Die Rs. ze...
Mu
Bezeichnung einer birmesischen Gewichts- und Münzeinheit bis zur Umstellung auf das Dezimalsystem am 1. Juli 1952. Es galten zuletzt 8 Pyas = 2 Pe = 1 Mu. 2 Mu = 1 Mat. 1970/71 wurden von den konservativen Aufständischen unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten U Nu (1948-1958, im Exil seit 1966) 80 kg Feingold aus den Beständen der Volksbefreiungsarmee (PLA) zu 1-, 2- und 4-Mu-Stücken im Gewicht von 1, 2 und 4 g (999 fein) gemünzt. Die in Ostbirma ausgegebenen St&u...
Mückenpfennige
Volkstümliche Bezeichnung für die kupfernen Pfennigmünzen, die Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg 1696 in Celle schlagen ließ, weil die Rosetten seitlich neben der Wertzahl wie Mücken aussehen.
Müller, Philipp Heinrich
Bedeutender Augsburger Medailleur und Münzstempelschneider, schuf seit 1677 eine Vielzahl künstlerisch hochwertiger Medaillen auf Herrscher, Persönlichkeiten und Ereignisse seiner Zeit. Er gab zusammen mit Lauffer und Kleinert eine Medaillenreihe der Ahnengalerie römischer Päpste heraus, schuf Medaillen u.a. zur Thronbesteigung Wilhelms III. von Großbritannien (1689), auf den Sieg Peter des Großen in der Schlacht bei Poltawa (1709) und auf den Sieg Karls XII. von Schweden bei der Schlacht...
Münchener Münzvertrag
Der Zusammenbruch des Alten Reichs nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress (1815) brachte die Aufhebung der Eigenstaatlichkeit vieler Territorien und damit die drastische Reduzierung münzberechtigter Staaten in den deutschen Gebieten. Das alte Münzgeld lief aber weiter um, auch wenn die prägenden Staaten gar nicht mehr existierten. Die unerträglichen Kleinmünzenverhältnisse in den süddeutschen Guldenländern veranlassten Baden und Württemberg um 1830 zu Reformversuchen, d...
Münchner Medaille
Im letzten Viertel des 19. Jh.s entstand in Frankreich eine stilistisch eigenständige Medaillenkunst, angesichts derer Alfred Lichtwark noch vor der Jahrhundertwende zur "Wiederbelebung der Medaillenkunst" (Dresden, 1897) in Deutschland aufrief. Die Voraussetzung dafür schuf der Medaillenliebhaber und Mäzen Georg Hitl, der nach Studium der technischen Neuerungen der französischen Medaille in seiner neu erworbenen Poellathschen Prägeanstalt in Schrobenhausen neue Maschinen aufstellen ließ, ...
Münzähnliche Gegenstände
Bezeichnung für technisch wie Münzen hergestellte Gegenstände, die aber ohne Geldcharakter sind, wie z.B. Gemmen, Jeton, Marken, Medaille, Medaillon, oder Plaketten oder Verdienstmedaillen (Orden).
Münzaufbewahrung
Die Münzaufbewahrung dient der Erhaltung von Sammlermünzen. Da nur Stücke in gutem Zustand ihren Wert behalten, ist die korrekte Münzaufbewahrung ein relevantes Thema für jeden Numismatik-Fan.
Die Münzaufbewahrung im Wandel der Zeit
Zum Aufbewahren von Münzen gibt es verschiedene Systeme. Die ersten Sammlungen wurden in den Münzkabinetten der Fürsten aufbewahrt. Die Münzaufbewahrung entwickelte sich seitdem jedoch stetig weiter.
Die ersten Münzalben bestanden aus Blättern mit durchsi...
Münzberufe
Münzknechte, Münzbeamte, Münzarbeiter
Im Münzwesen der römischen Kaiserzeit war der Kaiser der eigentliche Münzherr, wenn auch der Senat als Kontrollinstanz mit eingeschaltet war. Die administrative Leitung wurde vom „Praefectus monetae“ (eine Art Geldminister) wahrgenommen, der den Titel „Rationalis“ trug. Die technische Durchführung der Prägung oblag einem „Rocurator monetae“, dem die „Officinatores“ (Zweigstellenleiter) mit den verschiedenen Fachkräften unterstanden. ...
Münzbesuchsprägungen
Gedenkmünzen auf den Besuch eines Fürsten in der Münzstätte, die meist in Gegenwart des Gasts geprägt wurden und in der Schrift auf das Ereignis hinweisen. Manchmal durfte der Gast die Prägemaschinen sogar selbst bedienen. Die meisten Stücke stammen aus dem 19. Jh., besonders häufig in napoleonischer Zeit von der Monnaie de Paris. Zu den letzten Münzbesuchsprägungen in Deutschland zählt das 2-Mark-Stück des Deutschen Reichs aus Sachsen mit der Rückseitenaufschrift "ZUR ERINNERUNG AN...
Münzbild
Das Münzbild ist für die Identifizierung und Akzeptanz der Münze durch die Bevölkerung wichtig, vor allem in Zeiten mangelnder Schriftkenntnisse. Bei zweiseitigen Münzen unterscheidet man die für die Bestimmung entscheidende Vorderseite von der Rückseite. Zum Münzbild gehört die bildliche Darstellung, die Beschriftung und ornamentale Gestaltung. Im Allgemeinen wurde die bildliche Darstellung seitens der münzprägeberechtigten Instanz vorgeschrieben. Die Stempelschneider und Graveure ha...
Münzbildnis
Die Darstellung menschlicher Bildnisse auf Münzen tritt im griechischen Kulturraum bis zur klassischen Periode in der Regel nicht auf. Die griechischen Münzen dieser Zeit zeigen Bildnisse von Göttern oder mythologischen Figuren, die mit der Religion in Zusammenhang stehen. Die bildliche Darstellung von Politikern oder Tyrannen hätte der "freie Grieche" (Hellene) als sträfliche Anmaßung (Hybris) verstanden, sich mit den Göttern auf eine Stufe stellen zu wollen. Eine Wende trat in hellenist...
Münzbörse
Bei der Münzbörse handelt es sich um ein überregionales Treffen von Münzsammlern und -händlern sowie Numismatikern, die sich in regelmäßigen Abständen in Großstädten zusammenfinden. Die Verkäufer mieten einen Tisch, auf dem sie ihre Münzen anbieten. Besucher können nach Zahlung eines Eintrittsgeldes die angebotenen Stücke betrachten oder erwerben, neue Kontakte zu Sammlern, Numismatikern und Händlern knüpfen oder alte Kontakte auffrischen.
Chancen und Gefahren von Münzmess...
Münzbuchstaben
An markanter Stelle auf dem Feld der Münze angebrachter Buchstabe, der angibt, aus welcher Münzstätte die jeweiligen Stücke stammen. Der Münzbuchstabe als Zeichen für die Herkunft der Stücke löste die Münzmeisterzeichen und die Points secrets (in Frankreich) ab. Regelmäßig erschienen Münzbuchstaben auf französischen Münzen unter König Franz (François) I. (1515-1547). Im übrigen Europa kamen die Buchstabenzeichen im 18. Jh. in Benutzung. Da die Buchstaben nicht ausreichten, wurde...
Münze
1. Die Münze ist Geld in Form eines vom Staat durch Stempelung, Gewicht und Gehalt garantierten (handlichen) Stück Metalls, das als Zahlungs- und Umlaufmittel dient, wobei sich Metallwert und Nennwert auseinander entwickelten. Neben seiner ökonomischen Funktion tritt der Charakter eines Nachrichten- und Massenkommunikationsmittels via Schrift und Bild hervor. Geldeigenschaft und Mediencharakter geben der Münze den Doppelcharakter, von dem ihr historischer Quellenwert abhängt. Zum historisch...
Münzedikte
Auch Münzerlasse, -mandate, und -verordnungen, die den Münzverkehr in den Städten, Reichskreisen und Staaten ordneten. Sie bilden ein wichtiges geldgeschichtliches Quellenmaterial und werden als Spezialsammelgebiet betrachtet. Vor allem die meist in Form von Einblattdrucken vorliegenden Bekanntmachungen, die sich auf Verrufung, Außerkurssetzung oder Gegenstempelung alter Prägungen bzw. Inkurssetzung neuer Münzen beziehen oder vor Fälschungen und eingeschleppte...
Münzentwertung
Münzentwertung: ein wichtiges Thema für Sammler und Anleger
Die Münzentwertung ist ein facettenreiches und oft unterschätztes Thema in der Numismatik. Für Sammler, Anleger und Händler ist das Verständnis dieses Prozesses von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Definition und Bedeutung von Münzentwertung
Münzentwertung bezeichnet den Prozess, bei dem eine Münze im Laufe der Zeit an Wert verliert. Dies kann sowohl den nominalen als auch den Sammlerwe...
Münzentwürfe
Entwürfe werden von Künstlern und Medailleuren gefertigt, wenn eine neue Münze ausgegeben werden soll. Oft schreibt die für die Ausgabe von Münzen verantwortliche Instanz einen Wettbewerb aus und entscheidet sich anhand von Entwürfen für die Vergabe des Auftrags. Die Entwürfe werden anhand von Modellen eingereicht, die aus Gips oder anderen Materialien geformt werden.
Münzersatzmittel
Geld, das als Ersatz für Münzen als Zahlungsmittel im Umlauf war, wie Münzsurrogate, Marken, Notgeld und Token. Münzersatzmittel gibt es schon seit der Antike. Schon die Römischen Tessarae zählen dazu. Auch die Belagerungsmünzen und Feldklippen dienten in Kriegs- und Belagerungszeiten als Münzersatz. Die als Ersatz für das knappe Kleingeld von Privatleuten und Firmen geprägten Zahlungsmittel, die vor allem in Großbritannien und dessen Kolonien als Münzersatz dienten (im ausgehenden 1...
Münzetikette
Kleiner Zettel aus Papier oder dünner Pappe, der Daten zur Bestimmung und Beschreibung der Münze enthält. Vor allem bei Münzhändlern ist die Verwendung von Münzetiketten beliebt, die häufig unter die entsprechenden Münzen gelegt werden und auch die Preise der zum Verkauf angebotenen Münzen enthalten. Manchmal verweisen die Etiketten aber auch auf Karteikarten oder Standorte, in denen die Daten zur entsprechenden Münze zu finden sind. Für den...
Münzfälschung
Im Gegensatz zur Falschmünzerei bezeichnet die Münzfälschung das Nachahmen oder Verfälschen historischer Münzen, die nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel umlaufen, sondern von Sammlern gesucht und gehandelt werden. Schon seit den Anfängen des Münzsammelns in der Renaissance tauchten Fälschungen auf (Paduaner). Als Faustregel ist festzuhalten, dass in Blütezeiten des Münzsammelns auch die Münzfälscher Konjunktur hatten. Es gibt einige wenige berühmte Fälschungen. Die bekanntes...
Münzfunde
Streufunde
Münzen aus vergangenen Zeiten, die als Einzel-, Streu- oder Schatzfunde entdeckt werden. Am häufigsten kommen Einzelfunde vor. Wenn solche Einzelfunde sich auf archäologisch bedeutenden Gebieten häufen, so spricht man von Streufunden. Einzel- oder Streufunde können auch als Grabbeigaben, Opferplatz- oder Grundsteinfunde vorkommen, letztere meist in Verbindung mit anderen Gegenständen und Urkunden. Handelt es sich um viele Münzen aus verschiedenen Epochen, so spricht man von Mis...
Münzfuß
Der Münzfuß ist der Maßstab, der festlegt, wie viele Münzen aus einer Gewichtseinheit Metall geprägt werden sollen und welche Zusammensetzung die Legierung enthält: Der Münzfuß regelt also Schrot (Raugewicht) und Korn (Feingewicht) von Münzsorten im Verhältnis zu dem geltenden Münzgrundgewicht. Das Basisgewicht war in der Antike die Mine, aus der je nach Zeit und Region z.B. im äginäischen, attischen, babylonischen, korinthischen, persischen, phönizischen oder rhodischen Münzfuß ...
Münzgesetze
Verordnungen von Münzherren oder die Münzhoheit ausübenden Instanzen (Münzstände), die die Prägung, die Ausgabe, den Umlauf oder die Verrufung von Münzen regelten. Sogar aus der Antike ist uns zumindest Sekundärliteratur über Münzgesetze erhalten: So berichtet uns Aristoteles (Ath. pol. 10), dass Solon im Jahr 593 v. Chr. eine Münzreform durchführte, bei der er „die Münzen vergrößerte“, was auf die Einführung der Athener Tetradrachmen mit dem Kopfbild der Athene und der Eule ...
Münzgewichte
Gewichtsstücke, die zum Nachwiegen oder Prüfen des Gewichts und des Gehalts von Edelmetallmünzen hergestellt wurden. Mit Sicherheit gab es solche Gewichtsstücke schon in der späten römischen Kaiserzeit, wie die auf Gewichte und Nominale bezogen Aufschriften der Kupferstücke (Exagium) bezeugen. Aus dem 10. bis 12. Jh. stammen gläserne Münzgewichte aus Ägypten, die teilweise in kufischer Schrift beschriftet sind, z.B. „Richtiges Gewicht eines Dinars“. In Europa kommen Münzgewichte e...
Münzgulden
Rechnungsmünzen aus dem schweizerischen Luzern, die in den Jahren 1794 und 1796 als Goldstücke im Gewicht von 7,64 g (12 Münzgulden) und 15,28 g (24 Münzgulden) ausgeprägt wurden. Sie entsprachen im Gewicht der schweizerischen Duplone bzw. ihrem Doppelstück. Ihre Vs.n zeigen das gekrönte Wappen, in der Umschrift LVCERNENSIS REPUBLICA; auf der Rs. die Wertbezeichnung (12 bzw. 24/Mz:Gl:) und die Jahresangabe im Kranz.
Münzhandel
Die Bezeichnung für einen Fachhandel, der Münzen, Medaillen und sonstige numismatische Objekte zum Verkauf anbietet. Im 21. Jahrhundert meint dies nicht ausschließlich, aber dennoch hauptsächlich, den Vertrieb im Internet via Onlineshops. Auch das Zubehör, wie Münzschränke, -alben, Reinigungssets und numismatische Literatur gehört dazu. Viele Münzhändler und die Münzversandhäuser verschicken Lagerlisten und schließen auch artverwandte Objekte wie
Papiergeld
Münzwaagen
Münzgewicht...
Münzherr
Auch Münzstand, bezeichnet den Inhaber des Münzregals, dem als Münzberechtigten der finanzielle Gewinn aus der Münzprägung, der sog. Schlagschatz, zufiel. Bei den Münzherren handelte es sich in früheren Epochen meist um (geistliche oder weltliche) Fürsten oder Städte, nur selten um private Personen oder Körperschaften. Heute liegt die Münzhoheit beim Staat.
Münzkabinette
Die zwischen zwei Zimmern gelegenen Räume ohne eigenen Ausgang, wie sie in Schlössern seit der Renaissance vorzugsweise zur Aufbewahrung von Kunstwerken, Kuriositäten und Sammlungen dienten, wurden Kabinette genannt. Also waren Münzkabinette Räume, die den Fürsten zur Aufbewahrung ihrer Münzsammlung dienten. Die begüterten Sammler engagierten meistens Bedienstete, die eigens zum Aufbau und zur Betreuung der Münzsammlungen abgestellt waren. Diese erste...
Münzkartei
Verzeichnis der einzelnen Münzen und Medaillen einer Sammlung auf gesonderten Karteikarten. Bei der Vergrößerung der Münzsammlung um ein Objekt muss eine neue Karteikarte angelegt werden. Die Beschreibung der Sammelgegenstände auf den Karteikarten sollte immer nach dem gleichen Schema erfolgen, die Rückseite der Karte sollte für die Fotografie des Objekts reserviert sein. Die Karteikarten müssen nicht nach demselben System geordnet sein wie die Münzs...
Münzkartell
Zusammenschluss zweier oder mehrerer Staaten, die sich verpflichteten, die Falschmünzerei in den Partnerstaaten genauso zu bekämpfen wie die Fälschung der eigenen Münzen. Die ersten Münzkartelle entstanden 1845 unter den Mitgliedsstaaten des Deutschen Zollvereins. Im Jahr 1853 schlossen Preußen und Österreich ein Münzkartell ab, das auch die anderen deutschen Zollvereinsstaaten mit einschloss. Die Bekämpfung der Falschmünzerei, die zum ersten Ma...
Münzkatalog
Ein Münzkatalog ist ein systematisches Verzeichnis von Münzen, das anhand von Beschreibungen und/oder Abbildungen die Bestimmung und die Zuschreibung von Münzen ermöglicht. Aufgrund der Fülle des Materials sind die Münzkataloge Beschränkungen unterworfen. Meist sind sie geordnet nach:
Zeitlichen Gesichtspunkten wie Ausgabejahr beziehungsweise Jahrgang oder Jahrzehnt, Jahrhundert, Epoche
Geografischen Gesichtspunkten wie Ausgabeland, Staaten oder Kontinenten
Metallen also Goldmünzen, Sil...
Münzkontrakte
Vertragliche Vereinbarungen zwischen Münzherren (Münzständen) und Münzmeistern. Zwar war die Pacht der Münzstätte offiziell meist illegal, doch im Mittelalter und der frühen Neuzeit durchaus gängige Praxis. Münzkontrakte regelten die finanziellen und technischen Bedingungen für die Verpachtung der Münze. In neuerer Zeit vergeben vor allem kleinere Staaten ohne eigene Münzstätten Auftragsprägungen für ihre Münzausgabe...
Münzkonventionen
Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Münzständen oder Münzherren mit dem Ziel, ihre Münzprägung auf die eine oder andere Art zu vereinheitlichen. In der Regel wurden Münzkonventionen in politisch stark zersplitterten Regionen (Stadtstaaten, Kleinstaaten) getroffen, wie z.B. im antiken Griechenland und im Deutsch-Römischen Reich. Schon früh kamen griechische Kleinstaaten, Städte und politische Bünde überein, sog. Bundesmünzen zu prägen, d.h., sie trafen Absprachen, deren minimale...
Münzkopien
Anstelle fehlender Münzen werden in Sammlungen oft Münzkopien zur Ergänzung verwendet. Bei Ausstellungen, vor allem bei Wanderausstellungen, werden Kopien anstelle von echten, wertvollen Münzen verwendet. Zur Herstellung von Abbildungen und Fotografien stellt man auch Kopien her. Nachahmungen der Münze können im ursprünglichen Metall oder in abweichenden Legierungen hergestellt werden. Bei Abgüssen wird Gips, Blei oder Kunststoff, früher auch Schwefel...
Münzkosten
Auch Prägekosten, bezeichnet den Betrag, den der Münzmeister für sich geltend machte, nicht zu verwechseln mit dem Schlagschatz, den der Münzherr für sich in Anspruch nahm. Die Münzkosten bestanden zu einem Teil aus dem Gewinn des Münzmeisters (anstelle des Gehaltes) in Form einer Gewinnbeteiligung. Den anderen Teil verschlangen die Kosten für die Löhne der Mitarbeiter, die Werkzeuge und die Materialien. Unter Materialien ist vor allem das Kupfer zu v...
Münzkunde
Der Begriff wurde früher gleichbedeutend mit Numismatik verwendet. Heute ist der Begriff Numismatik weiter gefasst und umfasst neben den Gebieten Münzkunde und Münzgeschichte auch das Gebiet Geldgeschichte.
Münzlexikon
Bei einem Münzlexikon handelt es sich um ein Wörterbuch der Münzkunde, das in alphabetischer Reihenfolge numismatische Ausdrücke und Begriffe definiert, beschreibt oder erläutert.
Solche lexikalischen Werke gibt es seit dem 18. Jh. sowohl in Form von umfangreichen mehrbändigen Werken mit enzyklopädischem Anspruch, bis zu kleinen Bändchen, die nur über dürftige Informationen verfügen.
Ein wertvolles und heute noch verwendetes Münzlexikon ist das 1930 von Friedrich Freiherr von Schröt...
Münzmeister
Leiter bzw. Verwalter einer Münzstätte. Über die Aufgaben der antiken griechischen Münzmeister ist wenig bekannt. Auf manchen griechischen Münzen tauchen Signaturen von Münzmeistern auf, die sich auf zeitgleichen Prägungen anderer Städte wiederholen, sodass wir davon ausgehen können, dass ein Münzmeister für Münzen verschiedener Städte verantwortlich war. Über die Organisation römischer Münzstätten ist mehr bekannt: Dem „praefectus monetae“, eine Art Minister für die Finanz...
Münzmeistererzeugnisse
In den Münzkontrakten zwischen den Münzherren und Münzmeistern war letzteren neben der Herstellung von Münzen meist freigestellt, andere Prägegeschäfte auf eigene Rechnung zu betreiben. Dazu zählte die Prägung und der Vertrieb von Münzmeisterjetonen, Klippen (Abschläge von Münzstempeln auf rechteckigen Plättchen), Piéforts (Dickabschläge, vor allem der Pariser Münze), Goldabschlägen (von Silber- und Kupfermünzen), Silberabschlägen (von Kupfermünzen), Probemünzen (von Entwürf...
Münzmeisterjetone
Bezeichnung für Rechenpfennige, die von Münzmeistern in Münzstätten hergestellt wurden, im Gegensatz zu den speziell von Rechenpfennigschlägern hergestellten Stücken. Die von den Münzmeistern gestalteten und signierten Jetone waren eine Art Nebeneinnahme und dienten bis ins ausgehende 17. Jh. als Rechenpfennige, im 18. Jh. eher als dekorative Spielmarken. Die meisten stammen von Münzmeistern des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg im 17./18. Jh.
Münzmetalle
Siehe unter Aurichalkum, Aluminium, Aluminiumbronze, Billon, Bronze, Bronzital, Elektron, Glockenmetall, Gold, Italma, Kupfer, Kupferlegierungen, Magnesium, Magnimat, Messing, Nickel, Neusilber, Platin, Silber, Zink und Zinn.
Münznamen
Die Namen der Münzen gehen geschichtlich in der Regel auf die Bevölkerung zurück, weniger auf die Münzherren. Die Münznamen sind meist von Münzbildern abgeleitet (z.B. Krone, Kreuzer), am häufigsten kommt wohl die Benennung nach dargestellten Personen (Heilige, weltliche und geistliche Herrscher) und Wappendarstellungen (z.B. Adler und Löwen) vor. Bei vielen Münzbezeichnungen spielt der Humor und Spott des Volks eine große Rolle, u.a. bei Badehosentaler, Bezemstuiver, Bauerngroschen un...
Münzpächter
Seit dem Mittelalter verpachteten manche Münzherren oder Münzstände ihre Münzrechte an Dritte, meist an Münzmeister. In der Regel wurde die Pacht durch einen nicht unerheblichen Anteil am Münzgewinn bestritten (Schlagschatz). Da der Pächter die Münzprägung in der Regel auf eigene Kosten betrieb, d.h. seine Kosten und Gewinne aus der Münzprägung und einigen Nebenverdiensten bestreiten musste (Münzmeistererzeugnisse), brachte die Verpachtung oder Verpfändung der Münzstätte häufig e...
Münzplättchen oder -platte
Plättchen-Platte
Auch Platine, Ronde oder Schrötling, sind Bezeichnungen für die Metallplatten, die zur Prägung vorbereitet sind. Metallblöcke oder Zaine werden zu Bändern verformt, die schon die Dicke der Münzplatten haben. Diese Blöcke müssen dann nur noch ausgestanzt werden, um Münzplättchen zu erhalten, die dann geprägt werden. Siehe auch Münztechnik.
Münzpokal
Münzhumpen, Münzbecher
Münzpokale sind dekorative Trinkgefäße, die mit eingearbeiteten Münzen geschmückt sind. Je nach Form des Gefäßes werden sie auch als Münzbecher oder Münzhumpen bezeichnet. Sie sind meist aus Zinn oder Silber, manchmal auch aus Gold, wie der Trierer Münzpokal mit Tasse von 1732, der sich im Rheinischen Landesmuseum Trier befindet. Er zeigt 49 verschiedene römische Goldmünzen (vom 1.Jh. v. Chr. bis ins 6. Jh. v. Chr.), darunter 8 Nachahmungen und zwei neuzeitli...
Münzpolitik
Die frühesten Münzprägungen aus Elektron im späten 7. Jh. stammen aus dem Lyderreich (Kleinasien). Die ersten reinen Gold- und Silbermünzen entstanden nach 560 v. Chr. unter König Kroisos (Krösus), bevor das lydische Reich 547 v. Chr. von den Persern unter Kyros II. erobert wurde. Die persischen Großkönige aus der Dynastie der Achämeniden übernahmen die von den Lydern gemachten Erfahrungen und prägten eigene goldene Dareikoi und silberne Sigloi. Über die dem Lyderreich benachbarten ...
Münzprägestätten
Eine Münzprägestätte – auch Münzstätte oder Münzprägeanstalt genannt – ist ein Ort, ein Gebäude, eine Werkstatt oder eine Fabrik, in der Münzen hergestellt werden. Als Kurzbezeichnung wird auch der Begriff „Münze“ verwendet.
Zeitgenössische deutsche Prägestätten
Deutsche Münzen werden aktuell in fünf staatlichen Prägestätten hergestellt. Zu unterscheiden sind die Geldstücke aus den Münzprägestätten der Bundesrepublik Deutschland jeweils an der Kennzeichnung mit einem...
Münzprüfgeräte
Vorrichtungen in Münzautomaten zur Prüfung der Echtheit der eingeworfenen Münzen. Es gibt Leistenmünzprüfgeräte, die das Münzgeld im Durchlauf u.a. auf Dicke, Durchmesser, Bohrung, Prägetiefe und Gewicht prüfen. Magnetische Münzen werden von nichtmagnetischen mittels Haftmagneten getrennt. Legierungsprüfer prüfen ebenfalls im Durchlauf auf Dicke, Gewicht, Durchmesser und Bohrung. Nach Verlassen der Ablaufbahn fliegt die Münze durch...
Münzrecht
Münzhoheit
Das Münzrecht beschäftigt sich mit Fragen der Münzhoheit und mit den Vorschriften über Herstellung, Ausgabe und Umlauf der Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel. Das Münzrecht ist von Anfang an ein Zeichen der Souveränität des Stadtstaates oder des Tyrannen. Darauf wurde schon in den frühesten Zeiten der Münzprägung geachtet, wie schon das 547 v. Chr. unter die Herrschaft der persischen Großkönige aus der Dynastie der Achämeniden geratene Lydien zeigt: Unter der Herrsc...
Münzregal
Das Münzregal bezeichnet das Recht, die Münzordnung zu bestimmen, vor allem das Münzrecht finanziell auszunutzen. Das Münzregal lag (nach dem Vorbild des antiken Rom) unter Karl dem Großen strikt bei der fränkischen Krone, die für den Münzfuß, die Münzprägung, die Münznutzung und für die Errichtung und Verlegung der Münzstätten zuständig war. Seit dem 9. Jh. ging das Münzrecht, meist verbunden mit dem Markt- u...
Münzreihe
Sammlerbezeichnung für eine Reihe von Typen einer Münzsorte, z.B. sämtliche 2-Mark-Stücke der Bundesrepublik Deutschland.
Münzrendant
Der Ausdruck entstand im 18. Jh., als der für die Ökonomie des Münzbetriebs zuständige Münzschreiber Vorstand des Münzkontors wurde. Der Münzschreiber oder -rendant beschränkte die umfassende Macht des Münzmeisters.
Münzsammlung
Nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengetragene Sammlung von Münzen, z.B. nach Städten, Regionen, Völkern, Ländern, Zeiträumen, Epochen, Metallen, Nominalen, Themen, Motiven oder nach ästhetischen Gesichtspunkten. Meist sind mehrere Gesichtspunkte kombiniert. Da Universalsammlungen nicht mehr möglich sind, haben sich die Münzsammler darauf spezialisiert, entlegene und ausgefallene Sammelbereiche zu entwickeln oder einen repräsentativen Querschnitt d...
Münzschatzfunde
Schatzfunde
Eine große Anzahl von Münzen, die meist bei archäologischen Grabungen oder im Boden, häufig in Kästen, Krügen oder Truhen gefunden werden. Die umfangreichsten Funde antiker Münzen stammen aus Köln (konstantinische Zeit) und aus dem serbischen Nis. In Trier wurden 1995 mehr als 2500 Goldmünzen gefunden. Die Schatzfunde aus Mittelalter und Neuzeit stammen in der Regel aus Kriegs- und Notzeiten.
Münzscheine
Bezeichnung für Quittungen, die seit dem 18. Jh. für eingeliefertes Edelmetall oder Münzen ausgegeben wurden. Im Rahmen einer Münzreform konnten z.B. die abgelaufenen Münzen an die Münzstätte abgegeben wurden, die dafür Münzscheine ausstellte. Gegen die Münzscheine konnten dann die neuen Münzen wieder eingelöst werden. Die Bezeichnung wurde im 19. Jh. in Österreich auf das staatliche Papiergeld von 1849 und 1860 übertragen.
Münzschränke
Münzschränke sind ein Aufbewahrungsort für Münzsammlungen . Als solcher dienen sie dem Schutz von Münzen und Medaillen vor schädlichen äußeren Einflüssen und haben entweder die Form
eines Schranks mit flachen Schubfächern oder
eines Kastens mit flachen Einlegeböden.
Bauart der Münzschränke heute und früher
Die prächtigsten Münzschränke stammen aus der Barockzeit. Sie wurden für Fürstenhäuser aus edlen Hölzern und meist mit Elfenbeineinlagen in den Schubfächern gefertigt. ...
Münzstand
Fürstentum, Reichsstadt, geistliche oder sonstige (adlige) Herrschaft mit Münzrecht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Münzsurrogate
In den Zeiten der Metallwährung bezeichnete man Papiergeld oder Token, die in begrenzten Gebieten als Zahlungsmittel kursierten, als Münzsurrogat, da sie als Ersatz für Kurantmünzen gesehen wurden. Siehe auch Münzersatzmittel.
Münztechnik
Technische Verfahren zur Herstellung von Münzen. Um sich einen kurzen Überblick über die technischen Verfahren zu verschaffen, wird im Folgenden die Münzherstellung vom Metall zur geprägten Münze beschrieben. Die Metalle werden in vorgeschriebener Legierung in einem Windofen geschmolzen. Die Schmelze wird in entsprechende Formen gegossen, früher in Sand- oder Tonformen, heute in Kokillen. Die industrielle Fertigung des 20. Jh.s sieht das Entgraten und Beschneiden der Zaine bzw. Metallblö...
Münzvereine
Wendischer Münzverein
Schon in der Antike vereinbarten griechische Stadtstaaten, nach gemeinsamem Münzfuß, teilweise sogar mit ähnlichem Münzbild, gleiche Nominale auszugeben, um den betreffenden Münzen größere Geltung zu verschaffen (Bundesmünzen). Im Mittelalter kennzeichnete die politische und monetäre Zersplitterung - viele Münzstände mit unterschiedlichen Münzfüßen und Bewertungen des Pfennigs, die ständigen Münzverrufungen und Beischläge - das deutsche Münzwesen. Schon b...
Münzverrufungen
Verrufungen, Monetagium
Das Einziehen der im Umlauf befindlichen Münzen und das Ersetzen durch neue Münzen war im Mittelalter ein gebräuchliches Instrument der Münzpolitik. Ursprünglich diente die Münzverrufung (lat. renovatio monetae) dazu, die karolingischen Pfennigmünzen im Frankenreich reichsweit durchzusetzen, denn in der Regel galten die Münzen nur auf den Märkten in der Nähe des Prägeorts als vollwertig, sieht man einmal von Handelsmünzen ab. Die Verrufung bewirkte auch die Er...
Münzverschlechterung
In den Zeiten der Metallwährungen zieht sich die Verschlechterung der Münzen wie ein roter Faden durch die Münzgeschichte. Schon in der Antike wird von Verschlechterung der Münzen durch Absenkung des Feingehalts oder Erhöhung des Nominalwerts berichtet. Der karolingische Pfennig war schon einer schleichenden Gewichtsverminderung unterworfen. Schließlich wurde im Mittelalter das Recht der Münzherren zur Bestimmung der Feinheit ihrer Münzen zur Münzverschlechterung benutzt. Oftmals war di...
Münzvertrag
Vertrag zwischen zwei oder mehreren Münzständen, die ein Münz- oder Währungsabkommen schließen. Im Hochmittelalter kam es bei schwacher oder fehlender Zentralgewalt zu Münzverträgen, in denen sich (in der Regel benachbarte) Münzstände verpflichteten, auf Nachahmungen oder Beischläge zu verzichten. Solche Verträge schlossen im Spätmittelalter Münzvereine (z.B. Wendischer Münzverein, Rappenmünzbund). In der Neuzeit kommen Verträge über gemeinsame Münzfüße (z.B. Zinnaischer, Lei...
Münzverwaltung
Die Münzverwaltung umfasst die Organisation, Einrichtung und Überwachung des Münzbetriebs. Im römischen Münzwesen leitete der "Praefectus monetae" (Geldminister) die Verwaltung, der von einem "Optio" (eine Art Münzmeister) unterstützt wurde. Was das Münzwesen der Merowingerzeit betrifft, schließt man von den Münzmeisterzeichen auf den Münzen auf eine starke Stellung des Münzmeisters (Monetarius), der die administrativen Aufgaben des kleinen Handwerkerbetriebs vermutlich selbst ausüb...
Münzwaagen
Feinwaagen waren zur Herstellung und zum Nachwägen von Münzen seit der Antike im Gebrauch. Da die Benennungen vieler alter Münzen von Gewichten abgeleitet sind (Libra, Litra, Uncia, Stater, Schekel), hat die im 16. Jh. entstandene historische Metrologie sich in engem Zusammenhang mit der Numismatik entwickelt. Bis zum Ende der Goldwährungen im frühen 20. Jh. waren die Münzwaagen zum Wiegen des Edelmetalls ein wichtiger Bestandteil des Münzgeldverkehrs. Schon die römische Personifikation ...
Münzwerkstoffe
Bezeichnung für die Metalle und Legierungen, die zur Herstellung von Münzen verwendet werden. Für die Wahl der Münzwerkstoffe waren folgende Gesichtspunkte bestimmend: Korrosionsbeständigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, lange Haltbarkeit, gute Prägbarkeit, Farbe, möglichst geringe Fälschbarkeit und Preis. Die klassischen Münzwerkstoffe, wie sie in den Zeiten der Metallwährungen verwendet wurden, sind Gold, Silber und Kupfer bzw. Legierungen aus diesen Metallen. Bei den antiken Münzen...
Münzwerkzeuge
Die zur Herstellung der Münzen verwendeten Werkzeuge und ihre Funktion sind unter dem Begriff Münztechnik aufgeführt. Unter den Prägewerkzeugen versteht man im engeren Sinn nur die für den eigentlichen Prägevorgang verwendeten Werkzeuge.
Münzwert
Kurswert, Katalogwert, Sammlerwert – der Münzwert eines Geldstückes setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener Faktoren zusammen. Dadurch kann der Wert einer Münze differieren, je nachdem welcher Wert gemeint ist. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die verschiedenen Formen des Münzwerts:
1. Materialwert (Metallwert)
Als in den Prägestätten noch Edelmetallwährungen hergestellt wurden, sollte der Wert des verarbeiteten Materials annähernd dem Nennwert des jeweiligen Gel...
Münzwesen
Der Ausdruck wird meist als umfassender Begriff für das Münzsystem, die Verwaltung, Herstellung und Technik sowie die Gestaltung der Münzen eines Landes benutzt. Der Begriff wurde in der Zeit der Edelmetallmünzen geprägt und oft gleichbedeutend mit Numismatik benutzt.
Münzzeichen
Im weiteren Sinn alle Zeichen, die sich auf die Herstellung der Münze beziehen, also Münzmeister-, Graveur-, Medailleur-, Stempelschneider-, Designer-, Emissions- oder Auftraggeberzeichen. Im engeren Sinn ist damit aber das Zeichen für die Herkunft der Münze, also das Zeichen für die Münzstätte gemeint. Die ersten Münzzeichen in diesem Sinn waren die Points secrets, unauffällig angebrachte Punkte auf französischen Münzen, die sich schon im ausgehenden 14. Jh. finden. Vereinzelt taucht...
Muraiola
Umgangssprachliche Bezeichnung der Billonmünzen des Kirchenstaats. Auf dem Gepräge tragen sie meist einen Heiligen und Wertangaben. Die Wertangabe kann z.B. in Baiocchi (Baiocco) angegeben sein.
Muschelgeld
Traditionelle Bezeichnung für vormünzliche Zahlungsmittel, die in Gebieten Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozeaniens umliefen. Da die Mehrzahl des Schmuckgelds nicht aus Muschelschalen, sondern aus den Gehäusen von Schnecken( Kaurigeld) hergestellt wurde, ist der treffendere wissenschaftliche Begriff eigentlich Molluskengeld. Die wichtigste Form des Molluskengeldes liegt in Gestalt von Scheibchen vor, die (wie Perlenketten) an Schnüren aufgezogen sind. Die Muschelgeldschnü...
Muschelstatere
Keltische Goldmünzen (Statere) aus dem böhmischen Gebiet, die auf den Rs.n muldenförmige Vertiefungen zeigen. Im Randbereich der Vertiefungen befinden sich meist feine Strichverzierungen, die im Bild an eine Muschel erinnern, daher der Name Muschelstater. Die Vs.n zeigen meist einen unregelmäßigen Buckel. Die Muschelstatere werden der sog. Älteren Goldprägung der Kelten zugeordnet, die etwa im 2. und 1. Jh. v. Chr. stattfand (nach Latènechronologie Stuf...
Musica in nummis
Sammelbezeichnung für Münzen und Medaillen, die sich mit dem Thema Musik beschäftigen. Sie zeigen Musikinstrumente, Musiker, Sänger, Gesangsvereine, Komponisten, Gebäude (Oper, Philharmonie) oder beziehen sich auf musikalische Ereignisse. Schon die frühen antiken Münzen aus dem griechischen Kulturkreis zeigen als Münzbild Sänger oder Götter sowie Musikinstrumente. Letztere sind Göttern zugeordnet z.B. die Lyra oder Chelys dem Gott Hermes oder die Kitara dem Gott Apollon( Kitharephore...
Müte
Volkstümliche Bezeichnung für eine Kleinmünze und einen Rechnungswert in Westfalen (Lippe, Ravensberg und Münsterland). Die Benennung leitet sich vermutlich von den niederländischen Mijten ab. Nach Schrötter wurde die Münze zum ersten Mal 1497 im lippischen Lemgo im Wert von 2 Pfennigen gemünzt. In der benachbarten Grafschaft Ravensberg war die Bezeichnung Müte ein Rechnungswert: 24 Pfennige = 15 Müter = 2 Schillinge. Nachdem die zwischen 1739 und 1763 geschlagenen, kupfernen 3-Pfennig...
Mwali
Reichverzierte Armreifen, die zusammen mit den Bagi (Halsketten) als symbolische und hochwertige Tauschobjekte am traditionellen Kula-Ringtausch beteiligt sind, der unter bestimmten Gemeinschaften stattfindet, die auf Inselgruppen (u.a. Trobriand ) an der Ostspitze Neuguineas beheimatet sind. Die Mwali wurden in Handarbeit gefertigt und sind - ähnlich wie ihre Gegenstücke, die Bagi, - aufwendig verziert. Als besonders wertvoll gelten besonders alte und große Stücke, deren (...