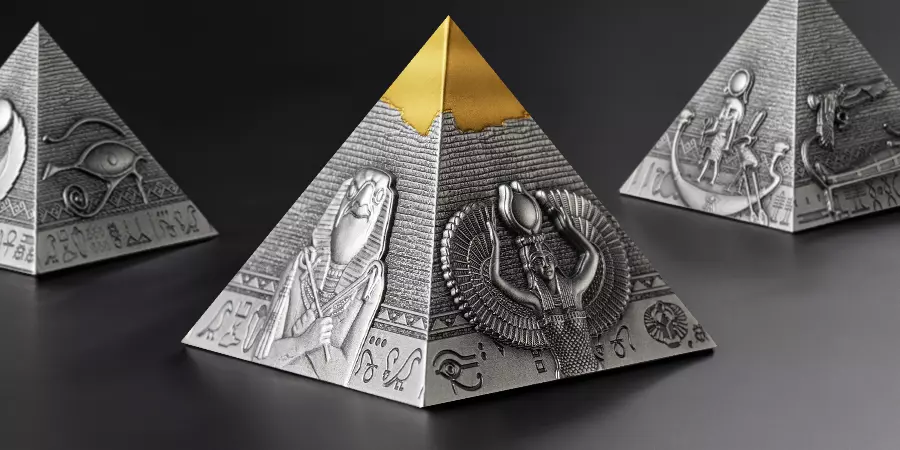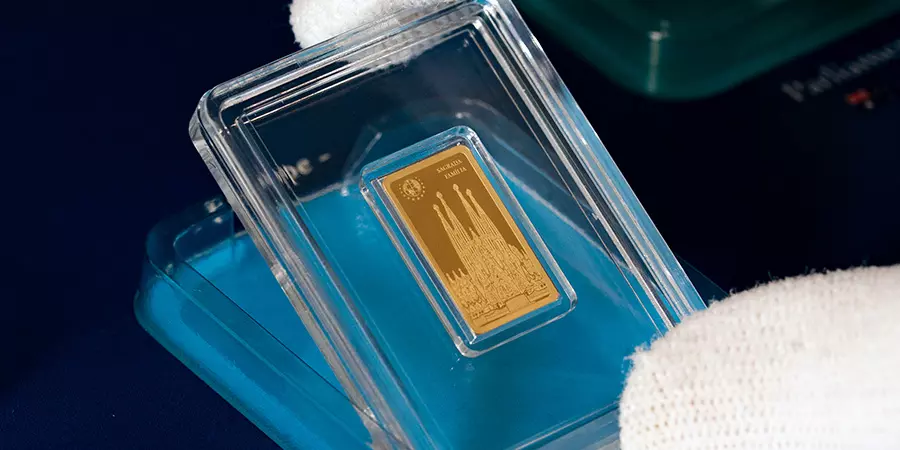Das große Reppa Münzen-Lexikon
Pfennig
Die Münzbezeichnung Pfennig besitzt eine lange Tradition und entstand bereits im 8./ 9. Jahrhundert im germanischen Sprachbereich. Der eigentliche Wortursprung ist jedoch ungeklärt.
Anfänge der Pfennige im Mittelalter
Der Ausgangspunkt der europäischen Pfennigprägung bildete der karolingische Silberpfennig, auch Denar genannt. Möglich wurde diese Münze durch die Münzreform unter dem Karolinger Pippin (751 bis 768), welche unter seinem Sohn Karl dem Großen (768 bis 814) beendet wurde. Auch das angelsächsische England lehnte seine frühen Pennys an die karolingischen Münzen an. Daher glichen sie sich in Gewicht und Feingehalt.
Mit dem Zerfall des Frankenreichs begann für den deutschen Pfennig (Denar 2), den französischen Denier, den italienischen Denaro sowie für den englischen Penny eine eigenständige Entwicklung. Von der karolingischen Epoche bis zum Ende des 13. Jahrhunderts waren die Silberpfennige, abgesehen von einigen selten ausgeprägten Teilstücken (Obol), das praktisch einzige Münznominal in den Gebieten des einstigen Frankenreichs und sogar über dessen Grenzen hinaus (Penning in Skandinavien, Nachprägungen des Denier tournois in den Kreuzfahrerstaaten).
In die Pfennigzeit fällt die stetige Entwicklung von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft, wobei in karolingischer Zeit ein West-Ost-Gefälle zu verzeichnen ist. Die Münzstätten verteilten sich bis in die vorottonische Zeit (936) ausschließlich westlich des Rheins - mit Ausnahme von Regensburg (Donau) und Würzburg (Main). Der Norden und Osten des Landes waren hingegen münzleer Erst durch die Entdeckung der Silbervorkommen an Harz und Erzgebirge und deren anschließende Nutzbarmachung, konnte diese Ungleichheit behoben und später sogar umgekehrt werden.
Die Karolinger und Sachsenherrscher prägten Pfennige zu Handelszwecken. Selbst unter den Saliern (1024 bis 1125) war es noch üblich, die Pfennige als Handelsmünzen (Fernhandelsdenare) zu gebrauchen, was die hohen Fundzahlen der Prägung in Schweden zeigen. Dort waren es vorwiegend Otto-Adelheid-Pfennige, welche als Beleg für den Wikingerhandel gelten.
Vielfalt der Pfennige
Die beeindruckende Historie der Pfennige ist auch verantwortlich für deren vielfältigen Ausprägungen. In unserem Münz-Lexikon finden Sie deshalb auch Informationen zu vielen weiteren Arten der Pfennige, beispielweise zu:
- Alderpfennig
- Goldpfennig
- Peterspfennige
- Sachsenpfennige
- Schlüsselpfennige
Zersplitterung des deutschen Münzwesens
Bis zum 10. Jahrhundert gab es nur eine Art des Pfennigs, die im kompletten Herrschaftsgebiet genutzt wurde. Mit der Politik der Münzverleihung der Ottonen (936 bis 1002) wurde jedoch der Grundstock zur Zersplitterung des deutschen Münzwesens gelegt. Um einen Gegenpol zu den immer mächtiger werdenden Stammesherzögen zu bilden und dadurch das Königreich zu stärken, wurden Münzdiplome an geistliche Fürsten und Äbte vergeben. Sie waren somit zur Münzprägung berechtigt. Der Plan misslang und statt der geplanten Machtfestigung wurde die Basis des Partikularismus des deutschen Münzwesens geschaffen.
In der Zeit der Salier (1024 bis 1125) und Staufer wurden die Münzrechtsverleihungen fortgesetzt. Selbst an Adlige und ganze Städte wurde dieses Recht im späteren Verlauf verliehen. Die zusätzliche Schwächung des Königreichs begünstigte die Zersplitterung zusehends - eine Entwicklung, die erst mit den Einigungsbestrebungen im 19. Jahrhundert beendet werden konnte. Parallel zu diesen Entwicklungen brach im 11. und 12. Jahrhundert die Ausfuhr der Pfennige nach Norden und Osten gänzlich ab. Diese wurden jedoch in der Städtegründungsperiode (1100 bis 1300) und den sich dadurch verstärkenden Handel als Zahlungsmittel für die städtischen Märkte benötigt.
Des Weiteren änderte sich im 11. Jahrhundert auch die Gewichtsbasis der Pfennigprägungen vom Pfund auf die Gewichtsmark (Mark I), die lokal verschieden schwer ausfielen. Die Münzherren konnten durch das Fehlen einer starken Zentralgewalt viele Münzverrufungen durchführen. Diese Verrufungen ergaben sich aus der Tatsache, dass die Pfennige zeitlichen und lokalen Schwankungen unterworfen waren und zudem nur regional begrenzt galten. Sie wurden immer wieder eingezogen und durch neue, meist schlechtere Prägungen ersetzt. Um diese Pfennige überhaupt voneinander unterscheiden zu können, wurden ständig die Münzbilder geändert, was sich am deutlichsten in den kunsthistorisch wertvollen Brakteaten niederschlug. Die bereits erläuterte Vergabe des Münzrechts an Städte erreichte im 13. Jahrhundert auch einige Handelsstädte. Diese versuchten eine für den Handel günstigere, im Silbergewicht stabile Münze zu schaffen. Aus diesen Bestrebungen resultierte der sogenannte Ewige Pfennig (im Lateinischen denarius perpetuus), der zuerst in Konstanz, Lindau und in einigen Bodenseestädten eingeführt wurde.
Vom Pfennig zur Deutschen Mark
Im 13. Jahrhundert wurde mit dem Aufkommen des Groschens die Pfennigzeit von der Groschenzeit abgelöst. Der Groschen entwickelte sich mit einem Normwert von 12 Pfennigen zur neuen Währungsmünze und die zeitgleich beginnende Goldprägung eignete sich besser als Zahlungsmittel für den Groß- und Fernhandel. Zu beachten sind neben den Groschen aber auch die Wertverhältnisse der neu aufkommenden Pfennigvielfache, wie etwa den Kreuzer zu 4 Pfennigen oder den Mariengroschen zu 8 Pfennigen.

Moderner Pfennig der Bundesrepublik Deutschland
Da der Wert des im 15. Jahrhundert aufkommenden Taler gewöhnlich 24 Groschen betrug, ergibt sich rein rechnerisch ein Wert von 288 Pfennigen pro Taler, der de facto aber in einem ganz anderen Verhältnis zu dem zur Scheidemünze gewordenen Pfennig stand. In der Neuzeit verloren die Pfennigmünzen weiter an Silbergewicht und wurden erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts auch in Kupfer ausgeprägt. Trotz all dieser Umbrüche und Veränderungen haben es die Pfennigstücke aber bis ins 20. und 21 Jahrhundert geschafft, als Hundertstel-Unterteilung der Deutschen Mark: 100 Pfennige ergaben in der BRD 1 Deutsche Mark.
Trotz seines geringen Werts war der Pfennig besonders beliebt. Ein Pfennig in der Geldbörse sollte seinem Besitzer Glück bringen und ein auf der Straße gefundener Pfennig galt als Vorbote für einen guten Tag. So wurde der Begriff Glückspfennig geboren.
An dieser ältesten deutschen Münzsorte lässt sich allerdings deutlich die nur phasenweise unterbrochene Entwicklung der ständigen Münzverschlechterung beobachten:
| Jahr | Silberanteil |
| 800 | 1,7 g |
| 1100 | 1 g |
| 1300 | 0,3 g |
| 1500 | 0,1 g |
| 17./18. Jahrhundert | 0,05 g |
Dieser Verfall der Kaufkraft verstärkt sich noch um ein Vielfaches, wenn man die sinkende Kaufkraft des Silbers in Betracht zieht.
Sammlerwert: Pfennige in der heutigen Zeit
Auch wenn der Pfennig seit der Einführung des Euros in Deutschland endgültig den Status als offizielles Zahlungsmittel verloren hat, ist er bei Sammlern nach wie vor beliebt. Geringe Stückzahlen, besondere Motive oder auch fehlerhafte Prägungen machen Pfennige zu einem echten Münzschatz, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!